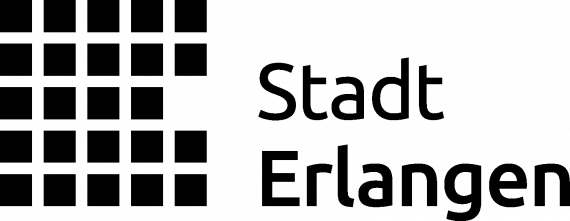Interview mit Joann Sfar
Das Gespräch führte Paul Salmona, Direktor des Pariser Musée d’art et d’histoire du Judaïsme (Museum für Kunst und Geschichte des Judentums) am 06.07.2023
Salmona: Wie erinnern Sie sich an die ersten Male, als Sie Ihren Vater in die Synagoge begleiteten?
Sfar: Ich ging an allen jüdischen Feiertagen und an jedem Schabbat in die Synagoge, bis ich 20 Jahre alt war. Wir feierten alle Feste und ich besuchte den Talmud-Tora-Unterricht[1] jeden Mittwoch und jeden Sonntag ab meinem sechsten Lebensjahr. Ich bin jemand, der viel weiß und nicht praktiziert. Als Kind erlebte ich die religiöse Praxis als einen Tribut, den ich meinem Vater zu zahlen hatte. Das war umso schwieriger, da ich meinen Großvater mütterlicherseits bewunderte, der ein überzeugter Antiklerikaler war, weil seine Familie im Holocaust erschossen worden war und er seine einzige Tochter verloren hatte. Er hatte in Bolechów[2] ein Studium zum Rabbiner absolviert und wusste alles über die Religion, die er aus Gewissensgründen verleugnet hatte. Was ihn nicht daran hinderte, Jiddisch zu sprechen, zutiefst zionistisch zu sein und alles zu lesen, was mit Juden oder Israel zu tun hatte.
Für mich kam die Freude an der Praxis am Familientisch bei meiner Großmutter väterlicherseits, weil ich die Schabbat-Abendessen sehr mochte. Ihr Judentum hatte mehr mit Magie und Aberglauben als mit Religion zu tun, aber das war für mich in Ordnung.
Salmona: Und das Seder[3] zu Pessach?
Sfar: Da wurde ich zum Zeichner: Die Zeichnungen der Pessach-Haggada[4] haben mich sehr geprägt, aber ästhetisch gesehen sind sie der sulpizianischen[5] Tradition zuzuordnen. Als ich klein war, wurde mir erzählt, dass das Judentum eine Religion sei. Um Jude zu sein, musste man also eine Religion ausüben, aber ich war wirklich nicht gläubig. Vielleicht bin ich es geworden … Ich habe gelernt, mir dieses Erbe zu eigen zu machen, mit der Überzeugung, dass das Judentum keine Religion, sondern ein Volk ist.
Salmona: Sie sagen: „Ich war wirklich nicht gläubig und bin es vielleicht geworden …?“
Sfar: Durch die Vorliebe für Rituale, durch das Ersetzen des Gebets durch das Zeichnen und Schreiben. Übrigens ist das Zeichnen vielleicht eine Religion … Jedenfalls bin ich durch das Judentum zum Zeichnen gekommen, durch die Askese, das Gebet, das Ritual … All das ist in meinem Zeichnen enthalten. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich praktiziere gerne und verbringe mein Leben mit dem Versuch, eine Antwort auf den Nihilismus zu finden. Nun findet man nie eine befriedigende Antwort, und in dieser Zwischenwelt sind das Zeichnen, das Schreiben, die Beobachtung der Realität, eine Liebe zu meinen Mitmenschen, die ich vielleicht bei Emmanuel Levinas[6] erworben habe, angesiedelt. Ich habe das Gefühl, dass man, wenn man ein Gesicht betrachtet, der Spiritualität näherkommt als wenn man auf eine Transzendenz hofft, auf die man so lange wie Platon warten wird …
Wenn Spiritualität hingegen bedeutet, die ästhetische Chiffre der Existenz zu entschlüsseln, Buchstaben und Formen zu finden, die wie ein kleiner Damm vor dem Nichts sind, dann ja!
Salmona: Welche Erinnerung haben Sie an den Talmud-Tora-Unterricht?
Sfar: Großartige Rabbiner und eine allgemeine idiotische Atmosphäre. In der säkularen und öffentlichen Schule war ich Klassenbester, während ich im Talmud-Tora-Unterricht eine Niete war. Ich wurde dort bestraft, weil ich das Pech hatte, zu behaupten, dass Adam und Eva ein Symbol seien, was mein Vater mir gesagt hatte. Ich erzählte ihm davon und er antwortete mir, dass man das nicht wiederholen dürfe!
Wenn ich in der Schule unter einer 18[7] blieb, war das eine Tragödie, während ich keine Schuldgefühle hatte, wenn ich im Talmud-Tora-Unterricht eine Klasse wiederholen musste. Eine Sache, die mir gefiel, war, dass ein Rabbi uns Gänsefedern brachte und uns wie in einer Sefer Tora[8] schreiben ließ: Ich fand es sehr schön, überall Tusche zu verteilen …
Salmona: Wann haben Sie angefangen zu zeichnen?
Sfar: Ich habe schon immer gezeichnet. Alle Kinder zeichnen und hören mit dem Eintritt in die sechste Klasse auf, weil behauptet wird, dass das Zeichnen ein Trittbrett zum Schreiben sei. Ich habe auch in der Pubertät nicht aufgehört – es war eine beruhigende Gelegenheit Präsenz zu zeigen. Mein Zeichnen hat mehr mit Totem als mit Ästhetik zu tun: Ich lasse Figuren existieren; sie sind bei mir und ich fühle mich wohl mit ihnen. In der Schule war ich nicht derjenige, der am besten zeichnen konnte, aber ich habe immer gezeichnet. Heute ist ein Unterschied zwischen meinen zeichnenden Mitschülern und mir meine ungebrochene Faszination für die Zeichnungen der anderen. Ich sehe ihnen weiterhin beim Zeichnen zu, als wäre es Magie, und ich arbeite mit einer Mischung aus Mystik und Überzeugung an meiner Zeichnung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich um eine Geisteswissenschaft handelt. Es ist für mich eine immense Quelle der Freude und eine Möglichkeit, das Dasein zu ertragen.
Der Antrieb, der mich zum Zeichnen bringt, ist derselbe wie der, der jemanden dazu bringt, Gebete zu sprechen. Und ich glaube, wenn man so viel zeichnet wie ich, dann hat man keine Zeit mehr für Gebete und sieht auch keinen Sinn mehr darin. Da der Ikonoklasmus im Zentrum des jüdischen Denkens steht, hört jeder Zeichner aus religiöser Sicht auf, Jude zu sein. Aber es ist eine Überschreitung, die dennoch akzeptabel bleibt. Das ist es, was die Propheten des Comics jüdisch macht – Jack Kirby, Will Eisner … –, weil ihre Praxis von einer Überschreitung ausgeht.
Salmona: Bilder gibt es im Judentum seit der Antike … Bezieht sich das Verbot wirklich auf die bildliche Darstellung?
Sfar: Das ist das Thema von „Der Götzendiener“, dem Album, das 2024[9] erscheinen wird. Es ist erlaubt, Bilder zu produzieren, um zu lehren, wenn es pädagogisch ist, wenn es darum geht, die Regeln der Realität zu verstehen, wenn es darum geht, zu erfahren, was Gott bei der Schöpfung erfahren hat. Was verboten ist, ist Götzenverehrung. Sind Comics eine Form der Abgötterei oder ihr Gegenmittel? Das ist eine Frage, die nicht entschieden werden sollte.
Salmona: Wann entdeckten Sie Chagall?
Sfar: Es war die Schule in der fünften Klasse, die uns zum Marc Chagall Museum in Nizza brachte. Und das war ein Schock. Hätte ich nur Asterix und Conan der Barbar gekannt, meine Lieblingscomics, hätte ich mich nie getraut, Comics zu machen, weil mir das zu „gut gemacht“ erschien. Nun wird man angesichts von Chagall nicht nur von der Macht der Werke überwältigt, sondern ich erinnere mich auch daran, wie ich vor den riesigen Gemälden auf dem Boden saß und mir sagte: „Ich will mitmachen!“ Deshalb bemühe ich mich seitdem bei jedem Kindercomic darum, dass der Held „leicht zu kopieren“ ist. Das ist bei „Der kleine Vampir“ und „Sardine aus dem Weltall“ der Fall. Chagall hat mich zur Malerei gebracht, während paradoxerweise mein Vater, obwohl er sehr belesen war, nie einen Roman las, nie ins Kino ging und mich nicht ins Museum mitnahm.
Salmona: Und Ihr Großvater mütterlicherseits, Arthur Haftel?
Sfar: Er las mir die „Ilias“ und die „Odyssee“ und Klassiker vor, aber auch englische Texte, damit ich die Sprache lernte, wobei er behauptete, dass es keine Übersetzungen gab. Er abonnierte für mich den „Readers’ Digest“, aber er hatte keine Leidenschaft für Literatur, Theater oder Oper. Er war bestrebt, die schöne Literatur und die klassische Kultur im Sinne der Integration weiterzugeben.
Salmona: Wie entdeckten Sie den Golem?
Sfar: Schon als kleiner Junge träumte ich davon, ein Judentum zu finden, das nicht nervt. Und ich muss sagen, dass mir die Mystik sehr gefiel, aber jedes Mal, wenn ich einen Fuß in die Tür setzte, sagte man mir im Talmud-Tora-Unterricht: „Das ist falsch. Es darf keine Kabbala bei den Juden geben; es darf keine Magie geben!“ Die Entdeckung von Serge Gainsbourg war außergewöhnlich, weil er endlich ein Jude war, der nicht nervte. Ich entdeckte den Golem als Teenager durch den Film von Paul Wegener[10] und das Buch von Gustav Meyrink[11], dann durch Jack Kirby[12], den Zeichner der „Fantastischen Vier“, der ständig Golems zeichnete und aus seinem Judentum kein Geheimnis machte, das gefiel mir sehr.
Ich erinnere mich, dass, wenn ich meinen Cousins, die sehr religiös waren, Fragen zum Golem stellte, wie: „Gibt es bei uns Magie oder nicht?“, sie mir antworteten: „Nein, es gibt keine!“. „Gibt es den Golem oder gibt es ihn nicht?“ Und die Antwort war, dass die eigentliche Frage lautet: „Muss man ihn in einem Minjan[13] zählen, wenn er eine Synagoge betritt?“ oder „Ist er ein Mann oder ist er eine Frau?“ Für den Moment interessierte mich das. Später, für meine Philosophiearbeit, las ich Moshé Idel, Andre Néher, Charles Mopsik … all die richtigen Autoren.
Salmona: Joseph Kessel und Romain Gary sind, wie Sie, Schüler des Lycée Masséna gewesen …
Sfar: Tatsächlich habe ich Kessel in der Grundschule entdeckt, mit einem Selbstdiktat über „Le Lion“, einem für mich grundlegenden Text, weil er die Ernsthaftigkeit des Kleinen Prinzen hatte. Gary habe ich erst viel später gelesen, in der Mittelstufe. Man muss wissen, dass Gary – der in Nizza ein Mythos war, genau wie Kessel – zu dieser Zeit als rechts galt, was mir nicht bewusst war. Ich denke, man war nicht in der Lage zu verstehen, was die gaullistische Utopie für einen jungen jüdischen Franzosen, der in Litauen geboren wurde, bedeutete. Für mich hatte es eine Bedeutung, weil mein Großvater mütterlicherseits, der seit Kriegsbeginn Widerstandskämpfer war, Russisch und Polnisch sprach und zu dieser Diaspora in Mittel- und Osteuropa gehörte. Er übersetzte die Papiere von Russen und Polen, die in Nizza landeten und nicht jüdisch waren. Und in seinem Umfeld gab es auch Libanesen, die nur „L'Orient-Le Jour“ lasen, und Iraner. Und Gary war in diesem Umfeld eine Referenz. Kessel auch.
Salmona: Waren Sie sich damals ihres Judentums bewusst?
Sfar: Ich wusste, dass Gary Jude war, aber bei Kessel wusste ich nur, dass er Russe war.
Salmona: Wie entdeckten Sie die Malerei?
Sfar: Als ich 14 Jahre alt war, lernte ich im Urlaub eine Pariserin kennen und bat meinen Vater um Erlaubnis, zu ihr zu gehen, weil wir uns ein bisschen geküsst hatten. Als ich in Paris ankam, erklärte mir das Mädchen, das damals 17 Jahre alt war, dass sie inzwischen einen „richtigen Mann“ kennengelernt hatte. Da ich in Paris nichts zu tun hatte, nahmen mich mein Cousin und meine Tante mit in die Museen. Sie zeigten mir das Picasso-Museum, das Centre Pompidou, den Louvre … Und sie sagten mir: „Wenn du Comics machen willst, ist das deine Entscheidung, aber dann musst du der Beste sein. Und für Comics muss man schreiben und zeichnen, also musst du dich weiterbilden.“
Ich ging zurück nach Nizza und meldete mich für das Theater und den Filmclub an. Und dort begeisterte ich mich sofort für den deutschen Expressionismus, den ich visuell liebte, und baute mir eine persönliche Filmkultur auf. Man muss dazu sagen, dass ich Horrorfilme schon liebte, bevor ich sie überhaupt sehen konnte, und mein Großvater mütterlicherseits kaufte mir alle Fachzeitschriften: „L'Écran fantastique“, „Midi minuit fantastique“, „Starfix“ … ich kannte alles, ohne die Filme gesehen zu haben!
Salmona: Und Soutine, der in den Alben über Pascin vorkommt?
Sfar: Ich entdeckte ihn im Musée de l'Orangerie. Seltsamerweise entdecke ich die gesamte Malerei auf einmal, Rembrandt und Soutine in derselben Woche. Bei Pascin kam die Begegnung viel später: Ich wusste, dass es ihn gab, weil es in der Villa Thiole, einer städtischen Schule in Nizza, wo ich Zeichnen und Malen lernte, Leute gab, die ihn sehr mochten. Ansonsten wusste ich nicht, wer er war, aber in Paris, an der Beaux-Arts[14], ging ich jeden Tag an der „Galerie Abel Rambert“ vorbei, die eine große Pascin-Sammlung hatte, die ich regelmäßig besuchte. Und eines Tages, ohne dass ich ihn um etwas gebeten hatte, schenkte er mir das Künstlerverzeichnis, vier riesige Bücher, und die Biografie von Pascin von André Bay. Rambert war Widerstandskämpfer gewesen und ich führte mit ihm Gespräche über die Résistance, die ich mit meinem Großvater nie geführt hatte, weil er nicht über die Kämpfe im Krieg sprechen wollte. Dieses Geschenk von Rambert hat mich sehr geprägt, dank ihm habe ich angefangen, Pascins Zeichnungen zu kopieren.
Damals wohnte ich in der Rue Guisarde und Roland Topor kam zu mir nach unten, um im Birdland[15] zu trinken, zu furzen und Chili con Carne zu essen. Ich saß neben ihm und zeichnete ihn, wagte es aber nie, ihn anzusprechen. Topor, Pascin, Gainsbourg sind Figuren, die sich in mir vermischten.
Salmona: In einigen Ihrer Porträts von Pascin erkennt man Gainsbourg, genauso wie der Malka in Band 2 der „Katze des Rabbiners“ die Züge von Romain Gary hat.
Sfar: Als ich zum ersten Mal ein Foto von Pascin sah, sagte ich mir: „Das ist Gainsbourg in Verkleidung“. Was den Malka, den Herrn der Löwen betrifft, so gab es ihn wirklich: Er war ein Jude aus Algerien, Synagogenvorsänger und Löwendompteur, der in den 1930er Jahren einen rechtsextremen Abgeordneten in Algerien ohrfeigte. Viele behaupten, er sei ihr Großonkel gewesen … Ich habe keine Ahnung, wie sein Gesicht aussah, aber es schien mir, dass ein braungebrannter Romain Gary gut aussah.
Salmona: Ihre Großmutter war auch eine Malka …
Sfar: Sie inspirierte die Figur der Zlabya unter anderem deshalb, weil sie atemberaubend schön war und alle meine nichtjüdischen Mitschüler jüdische Mädchen anhimmelten. Wenn ich dreißig Jahre gebraucht habe, um in „Die Synagoge“ die Geschichte des wütenden kleinen Juden zu erzählen, der Skinheads die Fresse poliert, dann deshalb, weil ich weiß, dass man dafür nicht geliebt wird. Wenn ich hingegen von dem hübschen Mädchen mit ihrer Katze erzähle, wird man mich eher mögen.
Salmona: „Die Katze des Rabbiners“ hat das Judentum in die französischen Comics gebracht, wo es zuvor nicht besonders präsent war.
Sfar: In meiner Arbeit gibt es viele unbewusste Dinge, aber in „Die Katze des Rabbiners“ war leider alles sehr bewusst. Meine Großmutter war gerade gestorben, und während ich meine Kindheit damit verbracht hatte, mein sephardisches Erbe nicht zu mögen, entwickelte ich eine Liebe für diese Kultur. Bis dahin hatte ich nur mein aschkenasisches Erbe geliebt, weil in meiner Familie alle gestorben waren, und das ließ mir Raum … Es war auch das Jahr, in dem ich Vater wurde, und das Jahr, in dem der Anschlag auf die Zwillingstürme stattfand. Damals versuchte man uns einen Kampf der Kulturen zwischen dem Orient und dem Okzident zu verkaufen. Ich hatte mich um ein Zentrum für Hausaufgabenhilfe gekümmert, war mit der maghrebinischen Jugend in Kontakt gekommen und wollte die maghrebinischen Erinnerungen neu verpacken, Algerien neu verzaubern und eine jüdische Familie in den Mittelpunkt stellen. Ich wollte ein Märchen über den Maghreb machen, mit Juden, die arabisch aussehen. Und ich habe sehr bewusst eine koloniale Bildsprache entlehnt, um Geschichten von kolonisierten Bevölkerungsgruppen zu erzählen.
Ich wusste also, warum ich „Die Katze des Rabbiners“ gemacht habe. Trotzdem waren wir alle vom Verkaufserfolg überrascht. So sehr, dass Dargaud ein Jahr lang praktisch jede Woche neu drucken musste. Und ich habe mich selbst reingelegt, weil das Religiöse bis dahin aus meinem Leben verschwunden war. Wegen der Katze kamen Rabbiner, Pfarrer, Imame und Pastoren zurück, die sich darüber freuten, dass man auf eine fast ungläubige Art und Weise über Religion sprach, und ich fand mich im Zentrum eines ökumenischen Wohlwollens wieder, das ich nicht gewollt hatte.
Salmona: Haben Sie sich für die Arbeit an der Katze vorbereitet?
Sfar: Ich gehe immer nach „bretonischer Art“ vor, d. h. ich arbeite mich in die Familienerinnerung ein, lese sehr viel und lege einiges für das Szenario beiseite. Und auch hier verwende ich bewusst Bilder, die eher aus den 1900er Jahren stammen, um Geschichten zu erzählen, die eher in den 1920er und 1930er Jahren spielen.
Salmona: Klezmer spielt in Osteuropa. Was wussten Sie über die Kultur des Yiddishland, bevor Sie mit dieser Serie begannen?
Sfar: Ich hatte keine Ahnung von Klezmer-Musik, weil man bei den Juden klassische Musik lernt. Mein Vater hatte rebelliert und war Jazzmusiker geworden, aber von Klezmer wussten wir nicht einmal, was das war. Selbst die jüdisch-arabische Volksmusik hörten wir nicht.
Salmona: Auch nicht Esther Malka, Ihre Großmutter?
Sfar: Sicherlich nicht. Sie war „Pariserin aus Sidi Bel Abbès“, aber sie gab vor, kein Arabisch zu sprechen. Ich war es, der das alles herausgefunden hat, weil es mir gefiel. Enrico Macias, den wir verehrten, sagte selbst nicht: „Ich bin jüdisch-arabisch.“ Er behauptete: „Ich mache arabisch-andalusische Musik.“
Mein Vater war Pianist. Als meine Mutter starb, hörte er mit dem Klavierspielen auf und ersetzte es durch die Religion. Und ich, mit 30 Jahren, erlaubte mir endlich, eine Mundharmonika und eine Ukulele zu kaufen. Und ich begann, alle Arten von Musik zu hören: Maalouf, Chaâbi, Klezmer … Und ich begann mit einer Recherche über Mittel- und Osteuropa, die mein Großvater nie gemacht hatte. Ich hatte Romain Gary gelesen, als ich 16 Jahre alt war, aber ich wusste nicht, wer Isaac Babel[16] war, ich wusste nichts über den jüdischen Bund[17].
Diese jüdische Vielfalt habe ich allein entdeckt: eine kosmopolitische jüdische Stadt wie Odessa, die keine anderen Ambitionen hatte, als in Europa zu bleiben; eine europäische jüdische Sprache wie Jiddisch... Als Kind wurde ich aufgefordert, modernes Hebräisch zu lernen, Ivrit[18], das ich übrigens nie gelernt habe. Die Idee, dass es eine europäische germanisch-jüdische Sprache[19] gibt, war überhaupt nicht zeitgemäß. Also habe ich mir eine kleine Folklore für meinen persönlichen Gebrauch neu erfunden.
Salmona: In Band 2 von „Klezmer“ drucken Sie in der Stadt des Massakers[20] das Gedicht von Haim Nahman Bialik über das Pogrom von Kischinew im Jahr 1903 ab, wann haben Sie diesen Text entdeckt?
Sfar: Als ich den ersten Band von „Klezmer“ veröffentlichte, wurde er sofort ins Englische übersetzt, und ich wurde zu einer Büchertour durch die USA mit einem Aufenthalt in New York eingeladen. Außerdem war ich eine Woche lang in den Archiven des Yivo[21]. Ich wurde sehr freundlich empfangen und mit Dokumenten über das Pogrom bombardiert. Nun war Kischinew nicht das schlimmste Pogrom[22], aber es war das erste, das fotografiert wurde, und es führte sogar zu Protesten der chinesischen Gemeinde in New York gegen die Brutalität des Zaren. Das bedeutet, dass das Ereignis weltweit Beachtung fand. Für die Fortsetzung von „Klezmer“ habe ich alles angesammelt, was es auf Französisch und Englisch gibt – ich kann kein Hebräisch lesen – über diese Themen. Ich arbeite übrigens gerade an der Adaption von „Klezmer“ für eine Fernsehserie und bin erstaunt, wie viel Wissen wir über die „verschwundene Welt[23]" osteuropäischen Juden haben.
Salmona: Zwischen Ihren ersten veröffentlichten Zeichnungen und den heutigen Zeichnungen ist ein „Loslassen“ festzustellen?
Sfar: Man muss sich in den Kontext der 1980er Jahre versetzen. Damals waren Comics verpönt und je mehr man sich der zeitgenössischen Kunst näherte, desto mehr wurden Comics geächtet. Das führte dazu, dass ich während meines Studiums an der Beaux-Arts in Paris in die Morphologie flüchtete, weil in den anderen Ateliers Comics verpönt waren. In den Anfängen war mein Zeichnen nicht akademisch, sondern sehr morphologisch und sehr auf eine getreue Darstellung der Realität ausgerichtet. Seitdem jage ich der Genauigkeit hinterher. Meine Meister sind Cabu, Toulouse-Lautrec, Rembrandt … das heißt, Künstler, denen es gelingt, eine Haltung mit der Genauigkeit eines Romanautors zu erfassen, wenn es ihm gelingt, die Sache korrekt zu beschreiben. Es ist eine dialektische Arbeit zwischen Beobachtung und Imagination, zwischen Konstruktion und Loslassen, es ist eine komponierte Zeichnung ohne Skizzen.
Am Anfang konnte ich viel besser zeichnen, da ich das Bedürfnis hatte, „gut zu zeichnen“. Heute muss ich richtig erzählen, also halte ich mich an anderen Dingen fest. Das Notizbuch, in das ich täglich zeichne, ermöglicht es mir, meinen konstruierten Comicvorschlag zu beleben, wie in „Die Katze des Rabbiners“. Das ermöglicht mir, dass meine Zeichnungen nicht einschlafen.
Salmona: Marcel Gotlib oder René Goscinny haben sich über ihr Judentum bedeckt gehalten, auch wenn es manchmal durchscheint.
Sfar: Ich gehöre nicht der gleichen Generation an: Gotlib oder Goscinny hatten einen Traum von Emanzipation, ich habe immer etwas über Juden gemacht. In „Paris-Londres“[24], meinem ersten Comic, heißen die drei Figuren „die Kabbalisteros“[25]; mein nächstes Buch ist „Die kleine Welt des Golem“[26]. Meine Motivation war es, einem erdrückenden Familienjudentum zu entkommen. Außerdem war meine erste Frau, mit der ich 25 Jahre lang zusammenlebte, keine Jüdin und mein Vater tat so, als würde sie nicht existieren. Da ich nicht vorhatte, sie zu verlassen und gleichzeitig am Judentum festhielt, erfand ich mein Judentum in meiner eigenen Ecke. Ich sammelte jüdische Dinge für meinen persönlichen Gebrauch. So wie Albert Cohen versucht hat, sich ein erträgliches Frankreich zu schaffen, indem er sich eingeschlossen hat, um die Klassiker zu lesen; so habe ich mir ein Judentum geschaffen, das meiner Frau und meinem Unglauben nicht feindlich gegenübersteht.
Salmona: In den Bemerkungen der Figur des Sokrates in „Herakles“[27], oder in den Diskussionen der Katze mit dem Rabbi finden sich Bezüge zur klassischen Philosophie.
Sfar: Es ist der Wunsch, der Jude unter Philosophen und der Philosoph unter Juden zu sein … Es sind zwei Denkweisen, denen ich mich verbunden fühle: das dialektische Denken Griechenlands und das jüdische Denken, der Dialog zwischen Athen und Jerusalem …
Salmona: Man hat den Eindruck, dass das Judentum, im kulturellen Sinne zunehmend mehr Raum in Ihrer Arbeit einnimmt.
Sfar: Ich habe das Bedürfnis, all das mit meinen eigenen Worten zu beschreiben, nicht mit denen meines Vaters. Diese Annäherung an das Judentum geht einher mit dem Wunsch nach dem Autobiografischen, nach dem Erzählen der Wirklichkeit, dem Zeigen der wahren Welt. Es ist jedoch möglich, dass ich dem Boden einen Fersenstoß versetze und wieder zu Merlin, dem Zauberer, aufbreche.
Interview veröffentlicht in: Musée d‘art et d‘histoire du Judaïsme (Hrsg): Joann Sfar. La vie dessinée. Paris, Dargaud, 2023. Aus dem Französischen: Stadtmuseum Erlangen
Anmerkungen
[1] Talmud Tora: Jüdischer Religionsunterricht, der Kindern erteilt wird.
[2] Bolechów in Polen (heute Bolekhiv in der Ukraine): Eine Stadt mit etwa 8000 Einwohnern Ende des 19. Jahrhunderts, von denen die Hälfte Juden waren. Der amerikanische Schriftsteller Daniel Mendelssohn erwähnt sie in „Les Disparus“ (Die Verschwundenen), Paris, Flammarion, 2006.
[3] Rituelles Abendessen, das an den ersten beiden Abenden des jüdischen Pessachfestes [eines der wichtigsten jüdischen Feste, das an den Auszug aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei erinnert] eingenommen wird.
[4] Haggada: Erzählung über den Auszug aus Ägypten, die in zahllosen illustrierten Ausgaben, auch für Kinder, veröffentlicht und beim Seder vorgelesen wird.
[5] Mittelmäßige religiöse Gegenstände, die in der Nähe der Kirche Saint-Sulpice in Paris verkauft werden.
[6] Emmanuel Levinas (1905–1995): französischer Philosoph litauischer Abstammung, der ein umfangreiches Werk verfasste und das jüdische Denken der Nachkriegszeit erneuerte.
[7] Französisches Notensystem auf der Basis eines 20-Punkte-Systems. 20 Punkte entsprechen der Note 1,0, bzw. „sehr gut“.
[8] Eine Torarolle mit den ersten fünf Büchern der hebräischen Bibel (Pentateuch), die von einem Schreiber (Sofer) mithilfe eines Kalams oder einer Feder auf Pergament kopiert und im Laufe des Jahres in der Synagoge in einem wöchentlichen Abschnitt (Parascha) vollständig gelesen wird.
[9] Paris, Dargaud 2024 & Berlin, avant-Verlag 2024
[10] Paul Wegener und Carl Boese: Der Golem, wie er in die Welt kam. Deutschland, 1920.
[11] Gustav Meyrink: Der Golem. Leipzig, Kurt Wolff Verlag, 1915.
[12] Jacob Kurtzberg, genannt Jack Kirby (1917–1994): US-amerikanischer Comicautor, der zahlreiche Serien schuf, die die Geschichte der US-amerikanischen Comics prägten.
[13] Minian: Quorum von zehn erwachsenen Männern oder Frauen, der für das Sprechen der wichtigsten Gebete in jedem jüdischen Gottesdienst unerlässlich ist.
[14] École nationale supérieure des beaux-arts de Paris; renommierte Pariser Kunsthochschule.
[15] Bar im Pariser Stadtteil Saint-Germain des Prés, deren Name sich auf den Spitznamen des Saxophonisten Charlie Parker bezieht.
[16] Isaac Babel (1894–1940), russischer Schriftsteller, der in Odessa in einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren und auf Befehl Stalins erschossen wurde, Autor u. a. von „Geschichten aus Odessa“ und „Die Reiterarmee“.
[17] Allgemeiner jüdischer Arbeiterbund Litauen, Polen und Russland, erste jüdische politische Partei, sozialistisch, marxistisch und säkular, gegründet 1897.
[18] Bezeichnung für das moderne Hebräisch im Gegensatz zum biblischen Hebräisch.
[19] Jiddisch ist eine jüdische Sprache germanischen Ursprungs, die in hebräischen Schriftzeichen geschrieben wird und hebräische (und in ihrer östlichen Version slawische) Begriffe mit mittelalterlicher deutscher Syntax und Lexik vermischt.
[20] Ein langes Gedicht, das Haim Nahman Bialik, einer der ersten großen modernen hebräischen Autoren, dem ersten Pogrom in Kischinew 1903 widmete. Er übersetzte eine erste hebräische Fassung ins Jiddische. Das Gedicht fand in allen jüdischen Gemeinden großen Anklang.
[21] YIVO (Akronym für Yidisher Visnshaftlekher Institut): Jiddisches wissenschaftliches Institut, das 1925 in Wilno (heute Vilnius) gegründet und 1940 nach New York verlegt wurde. Es bewahrt das größte Archiv über die jüdische Welt in Osteuropa auf.
[22] Beim ersten Pogrom in Kischinew (heute Chisinau, Hauptstadt von Moldawien) am 6. und 7. April 1903 wurden 47 Menschen getötet, 92 schwer und 500 leicht verletzt sowie 700 Häuser und Läden geplündert und zerstört. Der zweite, am 19. und 20. Oktober 1905, traf auf jüdische Selbstverteidigungsligen, die nach dem ersten Pogrom eingerichtet worden waren, und der es gelang, einige der Gewalttaten zu stoppen. Bis zum Ende der Unruhen waren 19 Juden getötet und 56 weitere verletzt worden.
[23] Vgl. Raphael Abramovitch: Di Farshvundene Velt – The Vanished World. New York: The Forward, 1947. Das in einer zweisprachigen Ausgabe in Jiddisch und Englisch veröffentlichte Buch listet Orte auf, deren jüdische Bevölkerung durch den Holocaust ausgelöscht wurde. Der Fotograf Roman Vishniac übernahm den Titel und veränderte den ursprünglichen Artikel in „A Vanished World“, New York, Farrar, Strauss & Giroux, 1983.
[24] Paris, Dargaud, 1998.
[25] Der Name ist aus dem Substantiv „Kabbala“ gebildet und bezieht sich auf die jüdische esoterische Tradition.
[26] Paris, L'Association, 1998 & Berlin, avant-Verlag 2006.
[27] „Socrate le demi-chien I – Héraclès“. Szenario von Joann Sfar, Zeichnungen von Christophe Blain, Paris, Dargaud, 2003. „Sokrates der Halbhund 1 – Herakles“. Szenario von Joann Sfar, Zeichnungen von Christophe Blain. Berlin, Reprodukt, 2011.