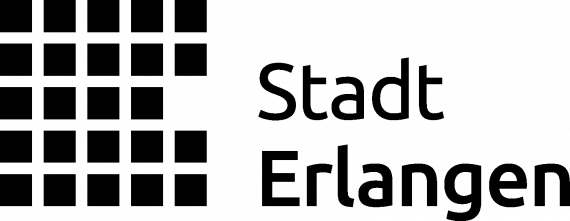Neue Wege in der Kunst und für die Kunst
Ab den späten 1960er Jahren vollzog sich in der westlichen Welt ein tiefgreifender Wandel, der Lebensgefühl und Wertesystem nachhaltig veränderte. Autoritäten wurden zunehmend infrage gestellt. Auch in der Kunstszene spiegelten sich die gesellschaftlichen Veränderungen wider: Viele Künstlerinnen und Künstler wollten aus dem traditionellen Kunstbetrieb ausbrechen; sie suchten nach neuen Wegen der Kunstvermittlung und innovativen Ausdrucksformen.
Zugleich etablierten sich in der kommunalen Kulturpolitik neue Strukturen. Angeregt durch Kulturpolitiker wie Hilmar Hoffmann in Frankfurt („Kultur für alle!“) oder Hermann Glaser in Nürnberg setzte sich in Erlangen die Auffassung durch, dass kulturelle Teilhabe ein Grundrecht und unabdingbare Voraussetzung demokratischen Zusammenlebens sei. Nicht nur die klassische „Hochkultur“, sondern auch soziokulturelle Initiativen und freie Gruppen sollten gefördert werden. Kunst wurde zum „Verwaltungsakt“, aber auch zum „Standortfaktor“.
Erlanger Wirtschaftsunternehmen und Banken traten vermehrt als Geldgeber und Sammler in Erscheinung und organisierten eigene Kunstausstellungen. Daneben entstand eine Vielzahl privater Galerien. Die Suche nach Künstlerateliers blieb in den beengten Erlanger Verhältnissen ebenso ein Dauerthema wie der Wunsch nach einer ständigen Kunstausstellung.
„Die arrogante und frostige Atmosphäre der Ausstellungshallen ist uns
zuwider. Werk und Künstler sollten gemeinsam dem Interessenten
gegenübertreten. Am besten auf dem Wochenmarkt.“
(Helmut Haunstein, 1965)
Video: Alt-OB Dr. Dietmar Hahlweg über die Kulturpolitik seiner Amtszeit

„Planstelle für Kulturreferenten“
Erlanger Tagblatt, 16. Dezember 1972
Stadtarchiv Erlangen
1960 wurde in Erlangen ein Kulturamt geschaffen, das zunächst anderen Ämtern unterstand. Es wurde ab 1963 von Oberstadtdirektor Otto Hiltl (1913–2002) geleitet. Die finanzielle Kulturförderung der Stadt stieg beträchtlich, allerdings hauptsächlich im Bereich Musik, während die Leistungen auf dem Gebiet der bildenden Kunst gering blieben.
1973 wurde das Referat für Sport, Jugend, Freizeit und Kultur geschaffen und Wolf Peter Schnetz (geb. 1939) als erster Kulturreferent bestellt. In seine Amtszeit fällt die Etablierung der Erlanger Festivals Figurentheaterfestival, Poetenfest und Comic-Salon unter Kulturamtsleiter Karl Manfred Fischer Anfang der 1980er Jahre.

Zeitungsausschnitt zur Ablehnung des Kulturpreises durch Herbert Martius, 1989
Erlanger Nachrichten, 24. Oktober 1989
Stadtarchiv Erlangen XL.1.98
Die Stadt Erlangen verlieh von 1962 bis 1991 einen Kulturpreis und ab 1963 den Kulturförderpreis. Dieser wird nach mehrjähriger Pause seit 2006 wieder regelmäßig alle zwei Jahre vergeben.
Herbert Martius lehnte 1989 die Annahme des Kulturpreises ab, um auf das aus seiner Sicht ansonsten herrschende auffallende Desinteresse der Stadtverwaltung an der bildenden Kunst aufmerksam zu machen.
 Oskar Stanik in seinem Atelier, 1965
Oskar Stanik in seinem Atelier, 1965
Foto: Hilde Stümpel
Stadtarchiv Erlangen VIII.3520.N.1/2
Der Barockbau aus dem 18. Jahrhundert besaß mit seiner historischen Innenausstattung, dem malerischen Innenhof und dem weinumrankten Laubengang einen besonderen Charme. Die Bausubstanz war allerdings dringend sanierungsbedürftig.
Die „Thalerei“ – ein gescheitertes Experiment
„Vereinigte Ateliers Erlanger Künstler“ – so lautete die offizielle Bezeichnung einer Künstlergemeinschaft, die von 1965 bis 1969 in der „Thalerei“ ihr Domizil hatte. Der Name des Barockgebäudes in der Inneren Brucker Straße ging auf die langjährigen Eigentümer, die Hofzimmermeistersfamilie Thaler, zurück.
1964 erwarb die Stadt Erlangen das Anwesen, um daran zu demonstrieren, „wie man auf sinnvolle Weise Denkmalspflege praktiziert“. Geld für die dringend notwendige Renovierung fehlte jedoch. Die Stadt ging daher gern auf den Vorschlag des Bildhauers Helmut Haunstein ein, das Gebäude einigen Künstlern zu überlassen. Im Herbst 1965 bezogen Haunstein, Otto Grau, Oskar Stanik, Bernhard Postner und Tugomir Huberger ihre Ateliers. Mit Ausstellungen und Diskussionsabenden weckte die Ateliergemeinschaft sofort das öffentliche Interesse. Von „Schwabing en miniature“ oder gar von einem „Erlanger Musentempel“ war die Rede.
 Hausbesetzer vor der „Thalerei“, 1969
Hausbesetzer vor der „Thalerei“, 1969
Foto: Otto Paul
Stadtarchiv Erlangen 33.13.P.253
Aus Protest gegen den Abbruch der „Thalerei“ kam es 1969 zu einer spontanen Hausbesetzung. Der Verlust des Barockgebäudes war die Initialzündung für die Gründung der „Bürgerinitiative Nördliche Innenstadt“, die sich in den kommenden Jahrzehnten für den Erhalt historischer Bausubstanz einsetzte.
Nach nur vier Jahren scheiterte das Projekt jedoch an der unzureichenden Unterstützung durch die Stadtverwaltung, aber auch an Differenzen der Künstler untereinander. Die ursprüngliche Fünfergruppe war bereits 1968 zerfallen.
Trotz Protesten wurde die „Thalerei“ 1969 verkauft und ein Jahr später abgerissen, um dem Neubau eines Ärztehauses Platz zu machen.

Oskar Johannes Stanik (1921–1989)
Selbstporträt mit Pinsel im Mund, 1962
Öl auf Sackrupfen
Dieses originelle Selbstporträt hing ab 1965 in der „Thalerei“.
Tugomir Huberger (1931–2001)
Drei Harlekine, undatiert
Öl auf Leinwand
Der in Zagreb geborene Künstler mit altbayerischen Vorfahren lebte seit 1957 in Erlangen, wo er auf der Rückreise von einer Ausstellung in Paris Station machte und von Freunden zum Bleiben überredet wurde. Seine großflächigen, in starken Farben gehaltenen Gemälde erregten sofort Aufsehen. Sie verbinden Einflüsse der manieristischen Malerei des 16. Jahrhunderts mit dem Surrealismus Salvador Dalís. Auf dessen Vorbild verweisen auch die extrem schlanken und überlangen Harlekine.


Helmut Haunstein (1928–2006)
Harlekin, 1962
Eisen
Von seinem Lehrer Huberger übernahm Haunstein nicht nur das Motiv des Harlekins, sondern auch die zartgliedrige, in die Länge gestreckte und gedrehte anatomische Konstruktion seiner Eisenfiguren. Im Hauptberuf Technischer Zeichner bei den Erlanger Stadtwerken widmete er sich nebenbei seiner Tätigkeit als Bildhauer, Zeichner und Aquarellist. Auf seine Initiative fanden im Foyer der Stadtwerke ab 1977 jährlich Kunstausstellungen überwiegend regionaler Kunstschaffender statt.
 Einweihung der Steindruckpresse im ZEKK, 1971
Einweihung der Steindruckpresse im ZEKK, 1971
Foto: Stümpel
Stadtarchiv Erlangen VIII.3577.N.1/6
Ein Hauptanliegen des ZEKK war es, die Grenze zwischen Künstler und Publikum zu durchbrechen. Das Herzstück der Einrichtung war daher die „grafische Werkstätte“ mit Lithografiepresse, die allen künstlerisch Interessierten offenstand. Das Angebot stieß auf große Resonanz.
„Den Künstler aus seiner Isolation holen“ – das ZEKK
Kurz nach dem Ende der „Thalerei“ fanden sich 1970 einige Künstler aus deren Umfeld zu einer neuen Gemeinschaft zusammen, dem „Zentrum für künstlerische Kommunikation“ (ZEKK). Noch stärker als bisher sollte der Fokus auf dem Austausch mit dem Publikum liegen. „Den Künstler aus seiner Isolation holen“, war das Schlagwort.
Die Stadtverwaltung stand dem Projekt aufgeschlossen gegenüber, stellte Räumlichkeiten in der Theaterstraße 3 zur Verfügung und förderte die Gruppe finanziell. Dennoch kam es wenig später zur Auflösung: Etliche Künstler zogen wegen günstigerer Arbeitsmöglichkeiten aufs Land.
Aufmerksamkeit erregte das ZEKK, als einige Mitglieder, die zugleich im Kunstverein aktiv waren, diesen öffentlich kritisierten und seine hierarchischen Strukturen als „unerträglich“ brandmarkten.
Kunst für alle – das Offene Atelier
Das Anliegen, den als elitär empfundenen Kunstbetrieb zu demokratisieren, lag auch der Gründung des Offenen Ateliers 1973 zugrunde. Der Verein aus Künstlern und Kunstinteressierten renovierte in Eigenregie sieben Räume in der Westlichen Stadtmauerstraße 19, im Gegenzug erließ die Stadt die Miete.
Um möglichst vielen Menschen die Gelegenheit zu künstlerischer Betätigung zu geben, wurden Werkräume und Geräte kostenlos bereitgestellt. Ein besonderes Augenmerk lag auf Personenkreisen, die im Kunstbetrieb meist durchs Raster fielen, wie etwa Straffällige, geistig oder körperlich Behinderte, ältere und isolierte Menschen sowie Kinder. Ebenso sollten Freizeitmaler, in Not geratene Künstler oder anderswo Abgewiesene eine Ausstellungsmöglichkeit erhalten.
Dieser Ansatz wurde in den folgenden Jahren mit einer Fülle von Angeboten und Ausstellungen umgesetzt. 1986 konnte eine ständige Galerie eröffnet werden, die noch nicht etablierten Künstlern eine Ausstellungsfläche bot.
Persönliche Konflikte und Rechtsstreitigkeiten unter den Mitgliedern führten schließlich zum Bruch innerhalb des Vereins. Ein Teil der Räumlichkeiten wurde an den stadtbekannten Maler Erhard Königsreuther, genannt „Pinsl“, abgetreten, der sein Atelier bis zu seinem Tod 2009 an diesem Ort betrieb.
 Ausstellung im „Offenen Atelier“, Dezember 1974
Ausstellung im „Offenen Atelier“, Dezember 1974
Rechts im Bild: Erhard Königsreuther („Pinsl“)
Foto: Stümpel
Stadtarchiv Erlangen VIII.3242.N.1/1
Erhard Königsreuther, genannt „Pinsl“, zählt vermutlich zu den bekanntesten Erlanger Malern. Dies verdankt sich vor allem seiner langjährigen „Regentschaft“ als bekrönter „König der Bergkirchweih“. Auf der Musikbühne des Erich-Kellers gab er seine Berg-Hymne („Ra-ra-ra!“) zum Besten, das Bier bezahlte er meist mit selbstgemalten Bildern. Königsreuther, ein höchst eigenwilliges Erlanger „Original“, starb 2009 mit 81 Jahren.

Kunst im Stadtbild
Erlangen trägt die Handschrift zahlreicher Künstlerinnen und Künstler. Ihre Werke finden sich in und an öffentlichen und privaten Gebäuden, auf Plätzen und in Grünanlagen.
Wichtige Auftraggeber und Förderer von Kunst im öffentlichen Raum waren und sind die Stadt- und Kreissparkasse, die Universität, lokale Unternehmen, aber auch Privatpersonen und Vereine. Seit den 1950er Jahren war es üblich, bei öffentlichen Bauvorhaben einen Teil der Auftragssumme (1–2 %) für „Kunst am Bau“ zu vergeben.
In den vergangenen Jahrzehnten fielen zahlreiche öffentliche Kunstwerke dem veränderten Zeitgeschmack, Gebäudesanierungen oder der Abrissbirne zum Opfer, einige mussten den Standort wechseln.
Erlanger KunstGuide für den öffentlichen Raum
Konzeption und Realisierung: Kunstpalais Erlangen

Lothar Strauch (1907–1991)
Spuckender Knabe, 1956/59
Bronze
Der Bildhauer Lothar Strauch ist mit einer Vielzahl an Arbeiten im öffentlichen Raum vertreten. Kennzeichnend für ihn sind seine wirklichkeitsgetreuen Figuren und Tierplastiken.
Helmut Lederer (1919–1999)
Königin, nach 1991
Bronze
Vielseitig wie kaum ein anderer hat sich Helmut Lederer auch mit Werken für den Erlanger Stadtraum einen Namen gemacht. Bei seinen Plastiken setzte er sich stets aufs Neue in der für ihn typischen Formensprache mit dem weiblichen Körper auseinander. Beispielhaft dafür ist die Skulptur „Königin“, die als 3,30 Meter hohe Figur auf dem Erlanger Rathausplatz Aufstellung fand. Obwohl als Auftragswerk genau für diesen Ort vorgesehen, kam es vor der endgültigen Aufstellung zunächst zu Diskussionen. 2020 wurde die Figur von einem LKW umgefahren und Anfang 2023 erneut schwer beschädigt.


inges idee
Entwurf für den Hasen im Röthelheimpark, 2015
3D-Druck
Das Berliner Künstlerkollektiv „inges idee“ gestaltet Kunst im öffentlichen Raum auf humorvolle, zuweilen auch provokante Art. Der mittels 3D-Druck erstellte Kunststoff-Hase ist das Entwurfsmodell zu der 3,80 m hohen Skulptur, die 2015 auf dem Grünzug am Röthelheimpark ihren Platz fand. Der extrem langohrige Hase soll dazu beitragen, dem Wohnquartier auf dem ehemaligen Kasernengelände der US-Streitkräfte eine neue, zivile Identität zu verleihen.

Skulpturen von Heinrich Kirchner
1975 wurden Werke des in Erlangen geborenen Bildhauers Heinrich Kirchner in einer Ausstellung auf dem Rathausplatz und in der Stadthalle gezeigt. Der Transport der außerordentlich schweren Großplastiken aus Bronze gelang nur mit Spezialfahrzeugen der in Erlangen stationierten US-Streitkräfte.

Bei einem Teil der Erlanger Bevölkerung stieß die Präsentation der Kirchner-Skulpturen auf Unverständnis: „Schwierige Kunst“ gehöre ins Museum, „wo sie den Passanten nicht herausfordert“, lautete eine Meinung. Auch die künstlerische Qualität der Werke wurde bemängelt.
Transport der Kirchner-Werke mithilfe von US-Militär-Fahrzeugen, 1975
Foto: Stümpel (Repro)
Stadtarchiv Erlangen VIII.19005.N.2/3
Die Kirchner-Plastiken auf dem Rathausplatz, 1975,
rechts im Bild Heinrich Kirchner
Foto: Stümpel (Repros)
Stadtarchiv Erlangen VIII.19009.N.6/6
Friedensbote (1980/1981) im Burgberggarten
Foto: Wikimedia Commons
Der Plan, die Kirchner-Plastiken anzukaufen und im Burgberggarten aufzustellen, rief erneut Proteste hervor. Dennoch wurde der Vorschlag 1979 mehrheitlich im Stadtrat angenommen. Kurz nach der Errichtung 1982 wurden die Kunstwerke in einem Akt von Vandalismus erheblich beschädigt.
Heute ist der Skulpturengarten Heinrich Kirchner eine Erlanger Attraktion.
Die geplante Neugestaltung des Lorlebergplatzes
Seit den 1960er Jahren gab es immer wieder Anläufe, die Mitte des Lorlebergplatzes neu zu gestalten. Bis 1946 stand dort ein elf Meter hoher Obelisk. Dieser war 1897 zu Ehren des ersten Deutschen Kaisers, Wilhelm I., errichtet worden, nach dem der Platz damals benannt war. 1962 schrieb die Stadt einen Wettbewerb zur Neugestaltung aus. Verschiedene Künstler reichten Vorschläge ein, darunter Helmut Haunstein, Heinrich Kirchner und Helmut Lederer, der mit einem neuen Obelisken ins Rennen ging. Durchsetzen konnte sich letztlich keiner der Vorschläge.


Helmut Haunstein (1928–2006)
Getroffener, 1962
Eisen
Haunsteins „Getroffener“ war eines der Werke, die 1962 beim Wettbewerb zur Neugestaltung des Lorlebergplatzes in die engere Wahl kamen. Nach Ansicht der Jury war es besonders gut als Denkmal für Werner Lorleberg geeignet. Dieser war kurz nach der Kapitulation unter bis heute ungeklärten Umständen einer Schussverletzung erlegen. Zu einer endgültigen Entscheidung kam es 1962 jedoch nicht.
Herbert Martius (1924–2009)
Entwurf eines Obelisken für den Lorlebergplatz, 1999
Papier, Karton, Filz, Holz
In den 1990er Jahren unternahm eine Bürgerinitiative einen weiteren Versuch der Umgestaltung. Unterstützt durch Kunstschaffende aus der Region, setzte sie sich die Errichtung eines von Herbert Martius entworfenen Obelisken aus Emaille zum Ziel. Im Mai 1991 wurde zu Demonstrationszwecken ein hölzerner Obelisk aufgestellt, der jedoch wenige Tage später von Unbekannten in Brand gesteckt wurde. 1999 wurde der Martius-Entwurf schließlich von einer knappen Mehrheit des Stadtrats abgelehnt. Der später von der Bürgerinitiative ins Spiel gebrachte Vorschlag einer von Bernhard Rein gestalteten Säule wurde ebenso wenig verwirklicht.


Bernhard Rein (1939–2021)
Modell für die Neugestaltung des Lorlebergplatzes, um 2014
Gips
Bernhard Rein absolvierte seine Ausbildung in der Staatlichen Fachschule für Holzbildhauerei in Oberammergau und an der Kunstakademie Nürnberg. Ab 1963 lebte er als freischaffender Bildhauer in seiner Heimatstadt Erlangen, die ihm im selben Jahr den erstmals vergebenen Kulturförderpreis verlieh.
Unverwechselbar ist der Stil Bernhard Reins. Seine verschlungenen Motive finden sich vielfach auf Brunnen und Skulpturen in der Stadt. Die künstlerische Gestaltung von Knoten galt als Spezialität des Bildhauers.
 Willi Hilpert
Willi Hilpert
Erlanger Galerieträume, um 1950
Zeichnung
Stadtarchiv Erlangen 32.84.T.31
Ironisch kommentierte Willi Hilpert bereits in den 1950er Jahren die manchmal hochfliegenden Pläne zu einer Erlanger Kunstgalerie.
Eine „Kunsthalle“ muss her!
Der Wunsch nach einer Erlanger „Kunsthalle“, einem ständigen Ausstellungsort für bildende Kunst, wurde seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von verschiedenen Seiten geäußert, scheiterte aber über Jahrzehnte an Standort- und Finanzierungsfragen.
Ab den 1950er Jahren richteten insbesondere der Gemeinnützige Verein (GVE) und der Kunstverein (KVE) regelmäßig Kunstausstellungen an wechselnden Orten aus. Während der KVE dabei einen regionalen Schwerpunkt setzte, war der GVE vorwiegend überregional ausgerichtet.
Die überregionale Kunst erhielt 1974 mit der Eröffnung der Städtischen Galerie im Palais Stutterheim (seit 2010 Kunstpalais) eine feste Bleibe.
Unterdessen verfolgten der KVE und ein 1989 gegründeter Förderverein weiterhin das Ziel, in Erlangen ein Museum für regionale Kunst zu etablieren. 1998 konnte schließlich das Kunstmuseum im Loewenichschen Palais eröffnen, das der Förderverein 2016 in städtische Trägerschaft übergab.