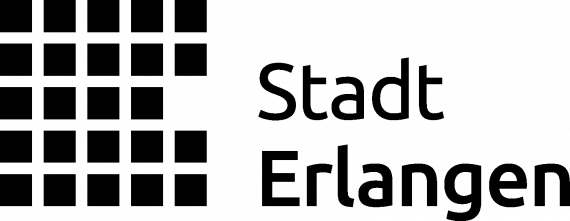Anything goes – Alles ist möglich?
Im Lauf des 20. Jahrhunderts hat sich der Kunstbegriff beträchtlich erweitert: Ob Digitalkunst, Street Art, Comics oder Land Art – thematisch und stilistisch sind heute kaum noch Grenzen gesetzt. Die Sammlung des Stadtmuseums kann diese Vielfalt nur ansatzweise abbilden.
Hatte Erlangen um 1900 noch einen Mangel an Ausstellungsorten zu beklagen, beherbergt die Stadt mittlerweile mehrere Häuser, die sich der bildenden Kunst verschrieben haben. Mit dem von der Stadt unterstützten Atelierhaus Thalermühle ging zumindest für einige Kunstschaffende der langgehegte Wunsch nach Atelierräumen in Erfüllung.
Auf der anderen Seite ist die Kultur von städtischen Sparzwängen häufig als Erstes betroffen. Darüber hinaus hat es regionale Kunst oft schwer, sich zu behaupten. Immer noch haftet ihr das Etikett des „Provinziellen“ an. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Kann Erlangen nicht nur Universitäts-, Medizin- und Siemensstadt, sondern auch Kunststadt sein?
„Leben kann man schon, aber nicht auf großem Fuß.
Ohne Auto, Altbauwohnung.“
(Herbert Martius über die Situation freischaffender
Künstler in Erlangen)

Michael Engelhardt (geb. 1952)
Die Zypresse im Kloster Hagios Athanasios auf Samothrake, 2005
Öl und Eitempera auf Leinwand
Einen Brückenschlag zwischen Realität und Traumwelt schafft der Erlanger Michael Engelhardt. In den extrem wirklichkeitsnah gestalteten Gemälden erschließt sich dem Betrachtenden eine Fülle von Symbolen, Zeichen und Anspielungen. Oft sind die rätselhaften Chiffren der griechischen Mythologie entlehnt.

Herbert Martius (1924–2009)
Ikarus, undatiert
Aquarell und Tempera
Das Ikarus-Motiv hat Herbert Martius zeit seines Lebens beschäftigt. In stets neuen Varianten setzte er sich künstlerisch mit der Erzählung von Hybris und Absturz auseinander.

Herbert Martius (1924–2009)
Stier, undatiert
Keramik, Emailbemalung und Holz

Herbert Bessel (1921–2013)
Abstrakte Komposition, 2003
Öl auf Leinwand
Herbert Bessel wurde in Hamburg geboren, lebte aber seit 1947 in Franken, wo er auch den größten Teil seiner Ausbildung absolvierte. Sein Spezialgebiet war das Gestalten von Fenstern und Fassaden. Im Raum Erlangen hat er sich in den 1960er und 1970er Jahren mit Kirchenfenstern einen Namen gemacht. In seinen Gemälden und Grafiken überwiegt das Abstrakte. Typisch für seine späteren Arbeiten ist es, bestimmte Assoziationen zu wecken, etwa bei diesem Arrangement von Strichlinien, das wie die Spiegelung von Grashalmen auf einer Wasseroberfläche wirkt.

Klaus-Hermann Kahlert (geb. 1949)
Durchblick, 2012
Bronze
Kahlert, im englischen Farnham geboren, aber seit seiner Kindheit in Erlangen ansässig, war über 30 Jahre als Kunsterzieher tätig. Daneben fertigte er zahlreiche Kleinplastiken, in denen er treffsicher und zuweilen humorvoll Körpersprache und Beziehungen von Menschen zu ihrer Umgebung thematisiert. Die Bronze „Durchblick“ spielt geschickt mit dem Perspektivwechsel zwischen dem Betrachtenden einerseits und einer selbst in beobachtender Pose dargestellten weiblichen Aktfigur andererseits.

Monika Schödel-Müller und Werner Nowka,
Schalengruppe „Farbe – Licht – Klang“, 2016
Feingefärbte Tonmassen
Seit 1979 arbeiten Monika Schödel-Müller und Werner Nowka in ihrem Gemeinschaftsatelier „fine art ceramics“ in der Heuwaagstraße und präsentieren dort ihre unverwechselbaren Keramikarbeiten. Neben mehreren internationalen Auszeichnungen erhielt das Künstler-Duo 2015 den Kulturpreis der Stadt Erlangen.

Lotte Funke (geb. 1938)
„Goethestraße, lebendige Vergangenheit“, 2004/05
Abschnitt eines elfteiligen Bilderfrieses
Öl auf Malkarton
Die gebürtige Nürnbergerin Lotto Funke kam 1945 nach Erlangen, wo sie auch heute lebt. Inspiriert durch die Eindrücke mehrjähriger Auslandsaufenthalte, vor allem in Asien, Irland und den Niederlanden, fand die Autodidaktin zur Ölmalerei. Funke gilt als Vertreterin des naiven Realismus, doch ist sie weit davon entfernt, in ihren farbenfrohen Werken nur eine heile Welt zu zeigen. Oft erst auf den zweiten Blick gewähren die detailreichen Bilder auch eine Sicht auf die Schattenseiten der dargestellten Szenen.
Die Gegenwart ist in die Darstellung der Goethestraße, die ein wichtiger Bestandteil des barocken Idealplans von Johann Moritz Richter war, explizit mit einbezogen. Dazu gehören ganz selbstverständlich Straßenverkehr und Passanten. Die historischen Gebäude sind den modernen Interessen angepasst oder mussten ganz weichen. Besonders krass zeigt sich der rücksichtslose Umgang mit historischer Bausubstanz bei dem überdimensionierten Bauwerk rechts. Um diesem Neubau Platz zu machen, war 1970 die historische „Thalerei“ abgerissen worden.

Kunstaktionen
Spektakuläre Kunstaktionen, Interventionen und „Happenings“ waren ab den 1970er Jahren ein gängiges Mittel, um die Grenze zwischen Kunst und Alltag, Künstler und Publikum aufzuheben.

Eröffnung der Ausstellung „Künstlerische Techniken“ des ZEKK, 1972
Foto: Stümpel (Repro)
Stadtarchiv Erlangen VIII.3578.N.2/2
Mit einer „action“ vor dem Palais Stutterheim zum Start ihrer ersten Ausstellung wollte die Künstlergruppe ZEKK ihr Ziel, mit den künstlerisch Tätigen und den interessierten Bürgern in Dialog zu treten, publikumswirksam unterstreichen.

Otto Piene, „Luftkunstaktion“, 1974
Foto: Hilde Stümpel (Repros)
Stadtarchiv Erlangen VIII.3493.N.2/12
Unter dem Begriff „Sky Art“ stand 1974 die „Luftkunstaktion“ des international bekannten Düsseldorfer Künstlers Otto Piene auf dem Erlanger Rathausplatz. Das Ziel: Luft sichtbar machen, äußere und innere Grenzen überwinden. Im Zentrum der Aktion stand die Helium-Befüllung eines 250 Meter langen Schlauches, der sich daraufhin in den Himmel erhob. Das Publikumsinteresse hielt sich in Grenzen: „Was in Pittsburgh und München tausende von erstaunten Zuschauern anlockte, interessierte in Erlangen ein paar Dutzend Leute“ („das neue erlangen“).

Junge Gruppe des KVE, „Ein Bild entsteht“, 1997
Foto: Hilde Stümpel (Repros)
Stadtarchiv Erlangen VIII.10355.N1/28
Als „Junge Gruppe“ definierten sich 1996 einige Mitglieder des Kunstvereins, die jünger als 35 waren. Die Vereinigung wollte den Nachwuchs fördern und neue Impulse setzen. An die Öffentlichkeit trat sie erstmals 1997 mit der Aktion „Ein Bild entsteht“. Dabei wurde eine vier mal fünf Meter große Leinwand gemeinschaftlich von zehn Künstlerinnen und Künstlern gestaltet.
Olivier Grossetête, Erlanger „Schlossfassade“, 2023
© internationales figuren.theater.festival – Foto: Georg Pöhlein
Eine der jüngsten Kunstaktionen im öffentlichen Raum fand 2023 auf dem Erlanger Schlossplatz statt: Im Rahmen des Internationalen Figurentheaterfestivals entstand dort ein Teil der Schlossfassade als Nachbau aus Karton und Klebeband. Hunderte Helferinnen und Helfer stellten die Einzelteile in fünftägiger Arbeit her und setzten sie vor Ort zusammen. Bereits am nächsten Tag wurde die Fassade zum Einsturz gebracht. Angeleitet wurde das Projekt von dem französischen Künstler Olivier Grossetête, der seine monumentalen „Ephemeral Buildings“ weltweit errichtet. Im Mittelpunkt steht dabei immer das Gemeinschaftserlebnis und der partizipative Aspekt.

Bunte Vielfalt – Galerien und andere Kunstorte
Unter dem Motto „Offene Türen – Kunst und Kultur in der Erlanger Altstadt“, später auch bekannt als „Durch die Altstadt zu Kunst“, konnten Kunstinteressierte bis 2011 einen Tag lang das kulturelle Angebot der Erlanger Innenstadt erkunden. Dem Publikum bot sich die Gelegenheit, Kunstschaffende in ihren Ateliers zu besuchen und in entspannter Atmosphäre einige der zahlreichen privaten Galerien kennenzulernen.
Die daran beteiligten Orte stellen aber nur einen kleinen Teil der zeitweise erstaunlich vielfältigen Erlanger Kunstlandschaft dar. Im Jahr 1977 ist von rund 20 Galerien die Rede. Neben kleinen privaten Studios wurde Kunst auch in Banken und in der Sparkasse, in Kaufhäusern und von Unternehmen wie Siemens gezeigt.
In jüngerer Zeit hat die Zahl der Galerien und Ateliers jedoch wieder abgenommen: Steigende Mietpreise, fehlende Förderung und mangelndes Kaufinteresse machen der lokalen Kunstszene zu schaffen.
 Hartmut „Max“ Beck (1940–2003)
Hartmut „Max“ Beck (1940–2003)
Foto: Hilde Stümpel (Repro)
Stadtarchiv Erlangen VIII.10073.N.2/6
Die Galerie Beck
Die Galerie Beck war über drei Jahrzehnte eine Institution der Erlanger Kunstszene. Dabei hatte sich der in Offenburg geborene Hartmut Beck, genannt Max, eigentlich nur kurzzeitig in der Stadt niederlassen wollen, um in Kunstgeschichte zu promovieren. Es kam anders: Inspiriert vom Wandel des Kunstbetriebs in den 1960er Jahren, gründete Beck 1968 eine Galerie im Erlanger Flessa-Hochhaus, die wenig später in die Schiffstraße und 1977 schließlich in die Theaterstraße 1 umzog.
Die dort gezeigte Kunst sollte möglichst allen Menschen zugänglich sein, langatmige Vernissagen waren Beck ein Graus. Sein feines Gespür war legendär: Er präsentierte Joseph Beuys und dessen Schüler Peter Angermann, Markus Lüpertz und Georg Baselitz – damals noch weitgehend unbekannt –, aber auch Werke regionaler Kunstschaffender.
Hartmut „Max“ Becks überraschender Tod 2003 hinterließ eine große Lücke im kulturellen Leben Erlangens.
 Die Galerie des Kunstvereins in der Hauptstraße
Die Galerie des Kunstvereins in der Hauptstraße
Foto: Erich Malter
Kunstverein Erlangen
Der Kunstverein Erlangen zeigt monatlich wechselnde Ausstellungen von Mitgliedern und Gästen aus dem deutschsprachigen Raum. Daneben besteht seit vielen Jahrzehnten ein reger Kunstaustausch mit dem Ausland, in erster Linie mit den Erlanger Partnerstädten. Jährlicher Höhepunkt im städtischen Kunstbetrieb ist der „Herbstsalon“, der 2017 die traditionelle Winterausstellung ablöste.
Über viele Jahre hatte der Verein mit unzureichenden Ausstellungsflächen zu kämpfen. Erste Verbesserungen brachten die „Kunststube“ in der Wasserturmstraße (1963–1971) und die „Kleine Galerie“ im Palais Stutterheim (ab 1972), bis schließlich 1996 die „Neue Galerie“ in der Hauptstraße 72 bezogen werden konnte.
Auf große Publikumsresonanz stieß von 1969 bis 1999 die vom Kunstverein ausgerichtete Biennale „Zeitgenössische Kunst in Franken“ auf Schloss Pommersfelden, eine der bedeutendsten Kunstausstellungen in der Region, in deren Rahmen ab 1993 der Kunstpreis der Nürnberger Nachrichten verliehen wurde.
 Das Kunstpalais im Palais Stutterheim
Das Kunstpalais im Palais Stutterheim
Foto: Erich Malter
Kunstpalais und Städtische Sammlung
Das Kunstpalais ist seit 2010 die Nachfolgeeinrichtung der Städtischen Galerie, die 1974 im Palais Stutterheim eröffnet wurde. Dem Haus ist die Städtische Sammlung angeschlossen, deren Grundstock Helmut Lederer ab den 1960er Jahren ehrenamtlich für die Stadt aufbaute.
Von 1976 bis 2002 standen Galerie und Sammlung unter der Leitung Karl Manfred Fischers. Mit seinem innovativen Ausstellungsprogramm, das die Wechselwirkung der verschiedenen Künste in den Mittelpunkt stellte, sicherte Fischer der Städtischen Galerie einen Ruf über die Grenzen der Stadt hinaus. Das Erlanger Publikum wurde mit neuen Entwicklungen und jungen Kunstschaffenden vertraut gemacht, vielfach bevor Vergleichbares in größeren Städten zu sehen war. Diese Ausrichtung wurde und wird von Fischers Nachfolgerinnen Lisa Puyplat, Claudia Emmert und Amely Deiss bis heute mit unterschiedlichen Schwerpunkten fortgeführt.
Gesammelt werden die wesentlichen Kunstströmungen seit 1945 am Beispiel von Grafiken, Serien, Künstlerbüchern, Fotografien und Videoarbeiten, darunter Werke von Marina Abramović, Joseph Beuys, Julius von Bismarck, Nan Goldin, Cy Twombly und Andy Warhol.
 Das Kunstmuseum im Loewenichschen Palais
Das Kunstmuseum im Loewenichschen Palais
Foto: Kunstmuseum Erlangen
Kunstmuseum Erlangen
Das Kunstmuseum entstand auf Initiative des 1989 gegründeten Fördervereins Kunstmuseum e. V. Der Schwerpunkt der Sammlung, die inzwischen mehr als 20.000 Werke umfasst, liegt auf der Kunst nach 1945 mit Beziehung zu Erlangen, Franken und der Oberpfalz. Das Kunstmuseum präsentiert im Jahr mehrere Einzel-, Gruppen- oder Themenausstellungen zu Malerei und Skulptur, Fotografie und Grafik.
Dem Erlanger Kunstmäzen Bernd Nürmberger (1940–2020) ist es zu verdanken, dass das Kunstmuseum seit 1998 im Loewenichschen Palais untergebracht ist. Bis 2002 wurde die Ausstellungsfläche durch einen modernen Anbau deutlich vergrößert. Besondere Verdienste um Sammlung und Ausstellungsprogramm erwarben sich der Historiker Jürgen Sandweg (1942–2017) und die Kunsthistorikerin Barbara Leicht.
Nach fast 20-jähriger ehrenamtlicher Leitung wurde das Museum im Juli 2016 in städtische Trägerschaft überführt, weiterhin unterstützt durch den Verein Freundeskreis Kunstmuseum Erlangen e. V.
 Blick in die Ausstellung „Hans Barthelmeß. Ein Künstler am Beginn der Moderne“, 2017
Blick in die Ausstellung „Hans Barthelmeß. Ein Künstler am Beginn der Moderne“, 2017
Foto: Erich Malter
Stadtmuseum Erlangen
Das Stadtmuseum Erlangen ist kein Kunstmuseum, verfügt aber über eine reichhaltige Kunstsammlung vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Diese entstand zunächst eher zufällig durch Schenkungen und Nachlässe, später wurde sie vor allem durch gezielte Ankäufe erweitert. Hervorzuheben ist die mäzenatische Tätigkeit des Apothekers und Kunstliebhabers Bernd Nürmberger (1940–2020), der durch Schenkungen und finanzielle Förderung erheblich zur Vergrößerung und Arrondierung der Sammlung beitrug.
Die vom Stadtmuseum gesammelten Kunstwerke weisen einen thematischen oder künstlerbiografischen Bezug zu Erlangen auf. Wichtigstes Sammlungskriterium ist dabei ihr „Quellenwert“ als Zeugnis der Stadtgeschichte. Aus der Gegenwartskunst hat sich das Stadtmuseum in Absprache mit dem Kunstmuseum ein Stück weit zurückgezogen.
Seit den 1960er Jahren zeigt das Stadtmuseum auch Kunstausstellungen, meist mit stadthistorischem Bezug. Eine dauerhafte Präsentation größerer Kunstsammlungsbestände, die bislang aus Platzgründen nicht möglich ist, wird bei der Neukonzeption der Dauerausstellung angestrebt.