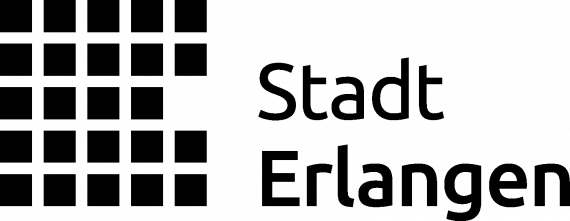Kunstleben in der Kaiserzeit
Erlangen war um 1900 eine kleine Universitätsstadt mit rund 20.000 Einwohnern. Das kulturelle Leben lag weitgehend in den Händen des bildungsbewussten Bürgertums. Mit dem 1904 gegründeten Kunstverein, der Königlichen Gemäldegalerie in der Orangerie („Kleine Pinakothek“) und dem 1914 eingerichteten Universitäts-Seminar für Kunstgeschichte etablierten sich Strukturen, die dem lokalen Kunstbetrieb neue Impulse gaben. Stiftungen und Spenden aus der Bürgerschaft ermöglichten die Errichtung von Denkmälern und Brunnenfiguren.
Eine „Kunststadt“ aber war Erlangen zu dieser Zeit nicht. Der Archäologe Ludwig Curtius, ab 1908 Professor an der Universität und Konservator der Gemäldegalerie, beklagte sich über die Provinzialität dieser „aller Kunst so abholden Stadt“, die er bereits 1918 wieder verließ. Viele der aus Erlangen stammenden Künstlerinnen und Künstler taten es ihm gleich: Sie gingen nach München oder Nürnberg. Den in Erlangen Gebliebenen gelang es meist nicht, allein von ihrer Kunst zu leben.
Das Bemühen einzelner Künstler, sich den Strömungen der Moderne anzunähern, fand mit der Zäsur des Ersten Weltkriegs ein vorläufiges Ende. Der Schatten des Krieges war lang: Während der 1916 bei Verdun gefallene Hans Barthelmeß posthum als Erlangens größter Maler gerühmt wurde, fiel der in Erlangen geborene und 1915 verstorbene englische Hofmaler Carl Haag bei manchen Kunstfreunden in „Ungnade“, da zwei seiner Söhne für Frankreich bzw. England gekämpft hatten.
„Im kunstreichen Bayern ist das kleine Erlangen
leider eine – ach! – so kunstarme Stadt.“
(Friedrich Haack, erster Privatdozent für
Kunstgeschichte in Erlangen, 1920)
 Anzeige des Kunstvereins / GVE, 1904
Anzeige des Kunstvereins / GVE, 1904
Erlanger Tagblatt, 1. Februar 1904
Stadtarchiv Erlangen 32.31.T.20
Kunstvereine gab es seit dem 19. Jahrhundert in fast jeder größeren deutschen Stadt. Auch der 1904 gegründete Erlanger Kunstverein hatte einen Vorläufer im „Akademischen Kunstverein“ (1843–57).
Das 1722 erbaute „Lange Haus“ (auch „Altes Gymnasium“ genannt) diente dem Erlanger Kunstverein als Ausstellungsort. Der Schwerpunkt lag auf zeitgenössischer Kunst des Naturalismus und Impressionismus, auf Blumen- und Tierbildern, Stillleben, Landschaften, Genreszenen und Porträts. Die ausgestellten Werke von Kunstschaffenden aus dem ganzen Reichsgebiet wechselten mindestens alle vier Wochen. Allein im Gründungsjahr des Kunstvereins wurden rund 1000 Arbeiten von über 200 Künstlerinnen und Künstlern gezeigt, darunter mindestens 48 Frauen.
Ein Verein für die Kunst
Der Erlanger Kunstverein wurde im Februar 1904 als Abteilung des Gemeinnützigen Vereins (GVE) gegründet. Schon im ersten Jahr seines Bestehens zählte er über 400 Mitglieder.
Der Verein setzte sich zum Ziel, in Erlangen eine ständige Kunstausstellung einzurichten, um das Publikum mit „Bestrebungen und Kunstrichtungen der Gegenwart“ vertraut zu machen. Zu diesem Zweck trat er dem „Verband süddeutscher Kunstvereine“ bei, der seine Mitglieder mit Leihausstellungen beschickte. Auch Neuerwerbungen des bayerischen Staates und Werke aus Erlanger Privatbesitz wurden ausgestellt, eine eigene Kunstsammlung besaß der Verein nicht.
In den ersten Jahren waren nur wenige der ausgestellten Künstler im heutigen Erlanger Stadtgebiet ansässig, darunter Adolf Schinnerer, der seit 1903 in Tennenlohe lebte, und Eleonore Schmidt-Herrling.
„Alte Meister“ in Erlangen.
Die Königliche Gemäldegalerie
Ab Januar 1906 waren in der Erlanger Orangerie rund 120 Werke „Alter Meister“ aus den Sammlungen der Alten Pinakothek in München ausgestellt. Die Einrichtung dieser „Königlichen Filialgemäldegalerie“ erfolgte auf Initiative der Universität und sollte vor allem der kunsthistorischen Bildung der Studierenden dienen. Aber auch bei der übrigen Erlanger Bevölkerung war die „Kleine Pinakothek“ überaus beliebt.
Die Verantwortlichen der Universität waren weniger angetan: Der Konservator Ludwig Curtius beklagte, dass man aus München vor allem zweitrangige Werke erhalten habe und einige wertvolle Stücke von Rubens und Cranach bald zurückgefordert wurden: „Ich habe keine Lust, nur als Einpacker guter Bilder, als Auspacker schlechter meine Zeit zu verlieren“.
1934 wurden sämtliche Gemälde zur Reinigung und Untersuchung nach München gebracht. Dies bedeutete faktisch die Auflösung der Erlanger Galerie, da seitens der Universität wenig Interesse an einer Fortsetzung bestand. Hatte der Kunsthistoriker Friedrich Haack den Besuch Nürnberger Museen für Erlanger Studierende 1928 noch als unzumutbar erachtet, hielt sein Nachfolger Rudolf Kömstedt eine Erlanger Gemäldegalerie für verzichtbar, zumal keine „würdigen“ Räume vorhanden seien.
 Blick in die Erlanger Filialgemäldegalerie
Blick in die Erlanger Filialgemäldegalerie
Postkarte
Heimat- und Geschichtsverein Erlangen
In umgebauten Räumen der Orangerie wurden rund 120 Gemälde aus dem 15. bis 18. Jahrhundert präsentiert, geordnet nach kunstgeographischen Schulen (Altniederländische, Deutsche, Flämische, Holländische und Italienische Kunst). Eine geplante Erweiterung der Galerie um jüngere Werke kam nicht zustande.


Adolf Schinnerer (1876–1949)
Reiter am Dechsendorfer Weiher, 1908
Öl auf Leinwand
Adolf Schinnerer gilt neben Rudolf Schiestl als „Entdecker der Erlanger Landschaft“, die er in zahlreichen Gemälden, Zeichnungen und Radierungen festhielt. Der gebürtige Oberfranke war u. a. in Erlangen aufgewachsen und hatte an den Kunstakademien in Karlsruhe und München studiert. 1902 ließ er sich als freischaffender Künstler in Tennenlohe nieder. Von der örtlichen Auftragslage bald enttäuscht, kehrte er 1911 nach München zurück, wo er nach dem Zweiten Weltkrieg Präsident der Kunstakademie wurde. Sein Einfluss zeigt sich im Frühwerk seines Schülers Hans Barthelmeß ebenso wie in den Arbeiten späterer Künstler, wie Peter Bina.

Hans Barthelmeß (1887–1916)
Landschaft mit Mädchen, um 1908
Öl auf Leinwand
Hans Barthelmeß, in Erlangen geboren und aufgewachsen, verspürte früh den Wunsch, Maler zu werden. In Adolf Schinnerer fand er bereits im Jugendalter einen Mentor, der ihn mit der Radierkunst vertraut machte. Nach einer Ausbildung zum Zeichenlehrer in Nürnberg ging Barthelmeß zum Studium an die Münchner Kunstakademie. Seiner Heimatstadt Erlangen blieb er bis zu seinem frühen Tod verbunden.


Hans Barthelmeß (1887–1916)
Aktkomposition mit drei Frauen, 1913–15
Öl auf Leinwand
In seinen frühen Werken orientierte sich Barthelmeß noch stark an der Malerei des Impressionismus, ehe er unter dem Eindruck seiner Studienreisen nach Amsterdam und Paris einen eigenen Stil entwickelte. Wenngleich er zur künstlerischen Avantgarde seiner Zeit auf Distanz blieb, finden sich in seinem Werk deutliche Anklänge an die Malerei der Moderne.
Selbstporträt als Soldat, 1916
Öl auf Leinwand
Unter dem Eindruck seiner Kriegserfahrung und persönlicher Schicksalsschläge wandte sich Barthelmeß in seinen letzten Lebensjahren einer gedeckten Farbpalette zu. 1916 fiel er im Alter von 28 Jahren bei Verdun. Sein Andenken wurde ab den 1920er Jahren in zahlreichen Ausstellungen gepflegt, der Kunstverein verwaltete ab 1939 einen Großteil des zeichnerischen Nachlasses.

Christian Klaiber (1892–1963)
Badeanstalt an der Regnitz, um 1912
Öl auf Karton
Der u. a. in Erlangen aufgewachsene Christian Klaiber malte dieses Bild im Alter von etwa 20 Jahren, kurz bevor er sein Studium an der Kunstakademie in München antrat. Die Darstellung der Erlanger Flussbadeanstalt steht in der Tradition des Impressionismus, der sich zu dieser Zeit anhaltender Beliebtheit erfreute. Klaiber, der bis 1934 in Erlangen lebte, avancierte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem der angesehensten Maler der Region.

Karl May (1884–1961)
Selbstporträt mit Mutter, 1917
Bleistift und Aquarell
Der Bildhauer Karl May wurde 1884 in Frauenaurach geboren. Wie viele Erlanger Künstler verließ er seine fränkische Heimat, um an der Kunstakademie in München zu studieren. In die Erlanger Region kehrte er häufig zurück – um seine Mutter zu besuchen, aber auch um in der reizvollen Landschaft zu zeichnen und zu aquarellieren.
Eleonore Schmidt-Herrling (1877–1960)
Waldstück in der Mönau, um 1932
Öl auf Leinwand
Eleonore Schmidt-Herrling gehörte über Jahrzehnte zu den prägenden Persönlichkeiten des Erlanger Kunstbetriebs. Ab 1902 hatte sie Malunterricht beim Künstlerinnenverein in München erhalten – an der dortigen Kunstakademie wurden Frauen erst 1919 zugelassen. Nach dem frühen Tod ihres Vaters, der Schriftsetzer beim „Erlanger Tagblatt“ war, hielt sie sich und ihre Mutter mit Malstunden über Wasser. Ab 1910 arbeitete sie an der Universitätsbibliothek Erlangen, wo sie u. a. die Graphische Sammlung betreute.
Schmidt-Herrling war mit ihren Werken – v. a. Blumenstücke und Landschaftsbilder – in vielen Ausstellungen des Kunstvereins vertreten, den sie mitbegründet hatte. Für die Tagespresse verfasste sie ausführliche Ausstellungsbesprechungen, anfangs unter dem Pseudonym „Papilio“.

 Blick in die Ausstellung. Auf der gelben Säule: Gabriele Münters Gemälde „Nach dem Tee II“ von 1912. Das Bild, das u. a. Wassily Kandinsky und den Kunsthändler Hans Goltz in Kandinskys Münchner Wohnung darstellt, wurde 1914 in Erlangen gezeigt.
Blick in die Ausstellung. Auf der gelben Säule: Gabriele Münters Gemälde „Nach dem Tee II“ von 1912. Das Bild, das u. a. Wassily Kandinsky und den Kunsthändler Hans Goltz in Kandinskys Münchner Wohnung darstellt, wurde 1914 in Erlangen gezeigt.
Kunst als „Faschingsscherz“?
Gabriele Münter in Erlangen
Im Februar 1914 zeigte der Kunstverein 52 Gemälde der Münchner Malerin Gabriele Münter, die heute unbestritten als bedeutende Vertreterin des Expressionismus gilt. Damals rief ihre Kunst beim Erlanger Publikum ein geteiltes Echo hervor. Eleonore Schmidt-Herrling schrieb in ihrer Rezension für das „Erlanger Tagblatt“:
„Daß die Ausstellung zufälligerweise gerade in den Faschingstagen zuerst gezeigt wurde, hat vielfach die Meinung erweckt, es handele sich bei Gabriele Münters Bildern tatsächlich um gut gelungene Faschingsscherze.“
Andere Besucher kritisierten das „Kindliche“ der expressionistischen Gemälde. Der wesentliche Unterschied zwischen Kinderzeichnungen und Münters Bildern, so Schmidt-Herrling, liege allerdings darin, dass Kinder „ganz naiv schildern, was ihnen in den Sinn kommt und so gut sie es eben können“. Münters Werke seien hingegen das „Produkt eines komplizierten Denkprozesses“. Voreilige Kritik an der Malweise sei deshalb nicht angebracht, denn: „Eine objektiv richtige Wiedergabe der farbigen Erscheinung der Dinge kann es ja überhaupt nicht geben.“