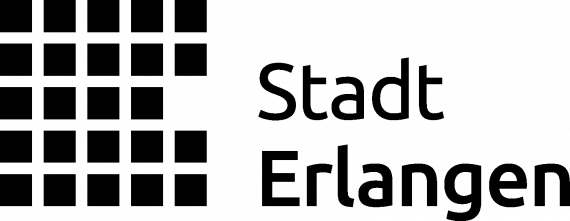Moderne Kunst in Krisenzeiten
Die erste Ausstellung des Kunstvereins nach dem Krieg eröffnete am 4. April 1920 in der Orangerie. Im selben Jahr fand dort auch die erste der beliebten Weihnachtsausstellungen statt, bei denen lokale Kunstschaffende ihre Werke präsentierten und zum Kauf anboten.
Ab 1922 übernahmen Studenten und Doktoranden des Kunsthistorischen Seminars den Ausstellungsbetrieb. Sie gründeten eine „Kunstgeschichtliche Arbeitsgemeinschaft“ (KAG) und richteten in der Orangerie einen „Raum für Graphik“ ein. Bis 1924 waren dort 20 Ausstellungen zeitgenössischer Kunst zu sehen, die Erlangens Ruf als Kunststadt beförderten. Überblicksschauen wie „Vom Impressionismus zum Expressionismus“ zeigten Werke von Max Liebermann, Lyonel Feininger, Emil Nolde, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Käthe Kollwitz und vielen mehr. Den regionalen Künstlern Ernst Penzoldt, Peter Bina, Hans Barthelmeß und Fritz Griebel waren Einzelschauen gewidmet.
Die gut besuchten Ausstellungen fielen in eine Phase höchster Anspannung: Hyperinflation, politische Morde, der Hitler-Putsch und die Folgen des Weltkriegs beherrschten die Schlagzeilen. Innerhalb kurzer Zeit stieg der Eintrittspreis der Orangerie von 1 Mark auf 10 Mark. 1924 kam der Erlanger Ausstellungsbetrieb weitgehend zum Erliegen. Erst die Neugründung des Kunstvereins 1930 sorgte für eine dauerhafte Wiederbelebung, nun allerdings unter konservativen Vorzeichen.
„... auch die Kunst schreit nach Brot und
wie schwer ist dieses gegenwärtig zu beschaffen!“
(Erlanger Tagblatt, 4. Dezember 1920)
 Kunstausstellung in der Orangerie, 1925
Kunstausstellung in der Orangerie, 1925
Fotografie
Stadtarchiv Erlangen VI.T.b.343
Die Moderne in der Provinz
Ab den 1920er Jahren war die Orangerie der wichtigste Ausstellungsort in Erlangen. Der „Raum für Graphik“ im Ostflügel wurde wegen seiner Farbgebung auch „Blaues Kabinett“ genannt.
Die Präsentation moderner Kunst war ein „kühnes Unternehmen, zumal in einer so konservativen Stadt“ (Christian Kazner). Erlangen übernahm damit in der Region eine Vorreiterrolle. Das „Gastspiel“ der Moderne war allerdings von kurzer Dauer. Eduard Rühls Aufgeschlossenheit für avantgardistische Tendenzen brachte ihn immer wieder in Konflikt mit konservativen Kreisen.
Die Erlanger Kunstkritik der 1920er Jahre schätzte Künstler, die „Übertriebenheiten“ und „Knalleffekte“ vermieden und „nicht wie die Expressionisten … alle Grenzen im mystischen Rausch“ verwischten. „Gemäßigter“ und „naturnaher“ Expressionismus fand allerdings durchaus die Gunst des Publikums: Er sei Ausdruck einer „genuin deutschen“, in der Gotik wurzelnden Kunsttradition. Malerei mit expressiver, „unnatürlicher“ Farbigkeit und der Tendenz zur Abstraktion wurde hingegen meist abgelehnt. Diese zwiespältige Haltung entsprach dem konservativen „Mainstream“ der Zeit.
 Anzeige für eine Expressionismus-Ausstellung in der Orangerie
Anzeige für eine Expressionismus-Ausstellung in der Orangerie
Erlanger Tagblatt, 1923

Jakob Dietz (1889–1960)
Gruß von der Erlanger Bergkirchweih, 1928
Farbkarte
Stadtarchiv Erlangen XIII.3.G.5
Der gebürtige Erlanger Dietz besuchte ab 1905 die Nürnberger Kunstgewerbeschule. Da er sich das Akademiestudium nicht leisten konnte, bestritt er seinen Lebensunterhalt als Gebrauchsgrafiker. Der Kunsthistoriker Friedrich Haack richtete ihm 1920 ein Atelier in der Orangerie ein. Als Maler war Dietz von Adolf Schinnerer und Hans Barthelmeß beeinflusst, die ihm Wege in die Moderne aufzeigten.

„Erlanger Heimatland“, 1920
Zwölf Ansichten von Eleonore Schmidt-Herrling und Jakob Dietz
Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg
Künstlerpostkarten und Grafikmappen für den „kleinen Geldbeutel“ waren für Kunstschaffende eine wichtige Einnahmequelle, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Beliebte regionale Motive waren die Erlanger Hauptkirchen, die Keller am Burgberg, die Wasserschöpfräder an der Regnitz, der „Saugraben“ sowie Ortansichten aus dem Umland.

Jakob Dietz (1889–1960)
Gefangen, um 1916
Holzschnitt
Stadtarchiv Erlangen VI.T.a.700
Kurz nach seiner Rückkehr aus der französischen Kriegsgefangenschaft war Jakob Dietz mit einigen Kriegsgraphiken auf der ersten Erlanger Nachkriegsausstellung vertreten. Die Presse schrieb: „Wenn ein oder das andere Blatt äußerlich keinen sauberen Eindruck macht, so möge man bedenken, daß der Künstler seine Sachen in seinen Schuhen heimbringen mußte, um sie an der Grenze drohenden Untersuchungen zu entziehen!“

Jakob Dietz (1889–1960)
Therese Dietz, 1929
Öl auf Leinwand
1932 stellte Dietz dieses Porträt seiner 79-jährigen Mutter in der Winterausstellung der Fränkischen Galerie in Nürnberg aus, wo es großen Anklang fand. Der endgültige Durchbruch als Maler gelang Dietz, der ab 1924 in Nürnberg wohnte, erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ernst Penzoldt (1892–1955)
Selbstbildnis als Soldat, 1916
Öl auf Leinwand
Ernst Penzoldt wuchs als Sohn des angesehenen Medizinprofessors Franz Penzoldt in Erlangen auf. Gegen den Willen, aber mit Billigung der Eltern studierte er ab 1912 Bildhauerei in Weimar und Kassel. Kurz darauf zog er als Soldat in den Ersten Weltkrieg – eine Erfahrung, die ihn nachhaltig erschütterte: „Vom Gott des Krieges angebrüllt stand ich lange verdutzt. Ich fand zuerst die Sprache wieder, die Hände waren noch ohnmächtig.“ Infolgedessen wandte sich Penzoldt nach dem Krieg zunächst der Schriftstellerei zu.

Ernst Penzoldt (1892–1955)
Weinender (Johannes), 1919/20
Bronze (Nachguss 1991)
Obwohl Penzoldt nicht im engeren Sinne gläubig war, schuf er zahlreiche Kunstwerke mit christlicher Motivik, vor allem Engelsdarstellungen und Heiligenfiguren. Die Darstellung des weinenden Johannes, die Penzoldt während seiner Akademiezeit schuf, ist expressionistisch beeinflusst.


Ernst Penzoldt (1892–1955)
Spielende Kinder, 1929
Öl auf Karton
Meine Kinder, 1929
Gips
Seine beiden Kinder Günther und Ulla wurden von Penzoldt häufig porträtiert, wie überhaupt Kinderbilder zu seinen bevorzugten Sujets gehörten.

Ernst Penzoldt (1892–1955)
Friedi in Helmbrechts / „Mehr haben wir nicht“, 1935
Öl auf Leinwand
Das Gemälde zeigt Penzoldts Frau Friederike („Friedi“), geb. Heimeran, und die beiden Kinder vor der väterlichen Fabrik, der Vogtländischen Buntweberei Heimeran im oberfränkischen Helmbrechts. Die Fliege in der unteren rechten Ecke verweist auf Penzoldts Pseudonym „Fritz Fliege“. Das Werk entstand für eine Ausstellung zum Thema Schmuck, konnte die Auftraggeber allerdings nicht überzeugen, da die abgebildeten Schmuckstücke – zwei Ringe und eine Kette – recht spärlich wirkten. Penzoldt kommentierte dies mit den Worten: „Wir haben leider nicht mehr“.


Georg Weidenbacher (1905–1984)
Knabe mit Papiermütze, 1929
Öl auf Sperrholz
Georg Weidenbacher besuchte die Kunstgewerbeschule in Nürnberg, wo sich auch sein Atelier befand. Mit der Erlanger Kunstszene stand er in engem Austausch, seine Werke wurden in der Orangerie ausgestellt. In dem Jugendbildnis von 1929 setzte er sich mit Tendenzen der Neuen Sachlichkeit und des Kubismus auseinander.
Fritz Griebel (1899–1976)
Dr. Hans Link, 1930
Öl auf Leinwand
Der Maler und Grafiker Fritz Griebel lebte und wirkte in Heroldsberg. Seine Orientierung an französischen Künstlern, v. a. Paul Cézanne, stieß schon in den frühen 1930er Jahren auf Kritik aus konservativen Kreisen, die alles „Fremde“ aus der deutschen Kunst verbannen wollten. Im „Dritten Reich“ wurde Griebel, der noch 1932 den Albrecht-Dürer-Preis erhalten hatte, nur noch selten ausgestellt. Nach dem Krieg, von 1949 bis 1957, leitete er die Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Das hier gezeigte Bild wurde ursprünglich als Selbstporträt Griebels angesehen, zeigt aber den Anwalt Hans Link.


Der Kunstverein fordert „gesunde Kunst“
Am 19. Dezember 1930 wurde der Kunstverein Erlangen (KVE) neugegründet – als unabhängiger Verein außerhalb des GVE. Den Vorsitz übernahm zunächst Friedrich Haack, ihm folgte der Arzt und „Hobbymaler“ Hermann Müller, im Hauptberuf stellvertretender Direktor der Heil- und Pflegeanstalt.
Unter der Leitung Haacks und Müllers veränderte sich das Profil der Erlanger Kunstausstellungen: „Volkstümlichkeit“ und „Naturnähe“ rückten als künstlerische Kriterien in den Mittelpunkt. Insbesondere Müller lehnte die internationale Moderne ab: „Die Wurzeln gesunder Kunst liegen immer in den Kräften des Volkstums“. Kunst, die „Entartung, Fäulnis und Krankheit“ in sich trage, müsse „von dem Strome der Zeit hinweggespült werden“.
Was der Verein unter „gesunder Kunst“ verstand, lässt sich an seinen Ausstellungen ablesen: Bereits vor 1933 wurden bevorzugt Künstler gezeigt, die im „Dritten Reich“ hohe Wertschätzung erfahren sollten, wie Edmund Steppes, Hermann Gradl, Hans Adolf Bühler oder Hermann Mayrhofer. Von den Erlanger Künstlern erlangte der Bildhauer Walter Bischoff höchste Anerkennung.
Einen Gegenpol setzte 1931 ein Vortrag des Nürnberger Kunsthistorikers Georg Wieszner. Im Erlanger „Volkshaus“, dem heutigen Stadtmuseum, referierte er über den „Pulsschlag deutscher Stilgeschichte“ und würdigte dabei auch moderne Strömungen, wie den Expressionismus, den Kubismus, die Neue Sachlichkeit und die Bauhausschule.
„Das Verhältnis des Volkes zur Kunst ist gestört. Hier will der Kunstverein einsetzen.“
(Erklärung des KVE, 1930)

Peter Bina (1888–1969)
Prozession in Hausen, 1932
Öl auf Leinwand
Peter Bina studierte in Nürnberg. Nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg arbeitete er als Zeichenlehrer, von 1923 bis 1953 am Erlanger Fridericianum. Hier prägte er das Kunstverständnis vieler Schülergenerationen. Als Künstler schuf Bina vor allem Landschaftsbilder und Ortsansichten. Die Erlanger Kunstkritik schätzte ihn als einen Künstler, der „abseits vom Kampfgeschrei der verschiedensten -Ismen unbeirrt seinen Weg geht“.
Walter Bischoff (1885–1945)
Selbstbildnis, um 1912
Gips
Walter Bischoff, der Kindheit und Jugend in Erlangen verbracht hatte, absolvierte in Fürth eine Lehre als Holzschnitzer. 1917 richtete er sein Bildhauer-Atelier in der Erlanger Friedrichstraße ein und machte sich durch die Gestaltung von Gefallenendenkmälern einen Namen. 1923 fand im Altstädter Rathaus, dem heutigen Stadtmuseum, eine erste große Bischoff-Ausstellung statt. 1930 folgte eine zweite Überblicksschau in der Orangerie, deren Besucherzahlen weit hinter den Erwartungen zurückblieben.
Hörstation: „Woran liegt es, daß die Menschen mehr zu den Affen laufen als zur Kunst?“


Walter Bischoff (1885–1945)
Kniende, 1929
Gips
Die „Kniende“ war 1930 als ein Hauptwerk Bischoffs in der Orangerie ausgestellt. 1938 wurde eine ähnliche Skulptur in der zweiten „Großen Deutschen Kunstausstellung“ im Münchner „Haus der Deutschen Kunst“ gezeigt, die als Aushängeschild regimekonformer Kunst fungierte. Bischoffs anti-modernistische Ästhetik erwies sich im „Dritten Reich“ als anschlussfähig.
Kriegerdenkmäler in Erlangen
Ab 1918 entstanden in Deutschland zahllose Denkmäler für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten. Viele der ausführenden Künstler – in der Erlanger Region u. a. Karl May, Walter Bischoff, Michael Baierlacher und Ernst Penzoldt – hatten selbst am Weltkrieg teilgenommen.
Während die in den 1920er Jahren ausgeführten Denkmäler meist das Totengedenken in den Mittelpunkt stellten, verwendeten spätere Arbeiten häufig militaristische und nationalistische Symbolik. Bisweilen sorgte die Gestaltung für Diskussionsstoff. Dabei ging es um ästhetische, aber auch um politische Fragen. Das 1930 im Erlanger Schlossgarten errichtete Gefallenendenkmal der Universität stieß wegen seiner revanchistischen Botschaft nicht auf allgemeine Zustimmung.
Umstritten war auch die Gestaltung eines geplanten städtischen Ehrenmals. Ein 1933/34 auf Initiative des Kunstvereins ausgerichteter Wettbewerb brachte kein mehrheitsfähiges Ergebnis. Auch der später gefasste Plan, den östlichen Teil des Bohlenplatzes (1933 nach Hitlers Mentor Dietrich Eckart benannt) in eine nationalsozialistische Weihestätte umzugestalten, wurden nicht verwirklicht.
 Das Gefallenendenkmal im Schlossgarten, um 1930
Das Gefallenendenkmal im Schlossgarten, um 1930
Fotografie
Das Gefallenendenkmal im Schlossgarten zeigte einen gefesselten Krieger mit Stahlhelm und zerbrochenem Schwert – ein deutlicher Verweis auf die „Fesseln“ des Versailler Vertrags. Im November 1946 wurde die militaristische Kriegerfigur auf Anordnung der US-amerikanischen Militärregierung beseitigt. Nur der Sockel und die seitlich aufgestellten Gedenksteine blieben erhalten.