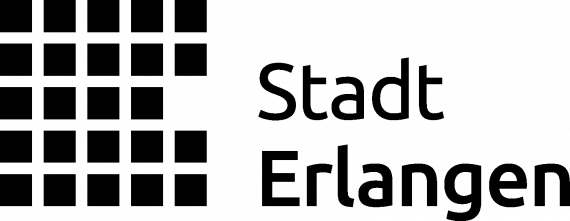Kunst unter dem Hakenkreuz
Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 stand der Kunstbetrieb in Deutschland unter staatlicher Kontrolle. Kunstwerke, die den Vorstellungen des Regimes nicht entsprachen, wurden als „entartet“ diffamiert.
Der Erlanger Kunstverein sah sich damit in seiner Ausrichtung bestätigt: Im Oktober 1933 erklärte der Vorsitzende Hermann Müller, dass keine „Gleichschaltung“ des Vereins nötig sei, da dieser „schon immer in eindeutiger Weise den völkischen Gesichtspunkt in der Kunstpflege betont hatte“.
Voraussetzung für die Aufnahme in den Verein waren nun „unbescholtener Ruf, deutsche Gesinnung und arische Abstammung“. Einige Mitglieder kehrten dem KVE daraufhin den Rücken oder wurden womöglich sogar ausgeschlossen.
An seiner eigenen Gesinnung ließ Müller keinen Zweifel. Vor dem Erlanger „Kampfbund für deutsche Kultur“ referierte er über die „Reinheit“ der deutschen Kunst, die vom „Weltjudentum“ bedroht sei. Bereits im Juli 1933 wurde in Erlangen eine Ausstellung „entarteter“ Kunst gezeigt, die „Mannheimer Schreckenskammer“.
Trotz reger Ausstellungstätigkeit blieben die Besucherzahlen während der NS-Zeit meist hinter den Erwartungen zurück. Eine der Ausnahmen war die Ausstellung „Fränkische Künstler“ im Juni 1944, zu der über 4500 Besucher erschienen. Es war die letzte Ausstellung vor Kriegsende. 1945 lösten die Alliierten den Kunstverein auf. Hermann Müller hatte sich kurz zuvor das Leben genommen.
„unbescholtener Ruf, deutsche Gesinnung
und arische Abstammung“
(Voraussetzungen einer Mitgliedschaft
im Kunstverein Erlangen ab 1933)
 Mitgliedskarte von Simon Rotenstein
Mitgliedskarte von Simon Rotenstein
Stadtarchiv Erlangen 32.84.T.16
Der Erlanger Kaufmann Rotenstein hatte sich am 24. April 1933 das Leben genommen.
Der Kunstverein wird „gleichgeschaltet“
Die Mitgliederversammlung im Oktober 1933 stand im Zeichen der nationalsozialistischen Machtübernahme. Die Satzung wurde „im Sinne der Gleichschaltung“ geändert, Hermann Müller als „Führer“ des Vereins eingesetzt. Ab 1934 waren zur Weihnachtsausstellung nur noch Mitglieder der „Reichskunstkammer“ zugelassen – was in der Erlanger Presse damals noch bedauert wurde.
Zwischen 1933 und 1934 schrumpfte die Mitgliederzahl des KVE von 150 auf 131. Der Grund für das Ausscheiden wurde in manchen Fällen in der Mitgliederkartei vermerkt:
- Gottfried Frör: „ausgetreten: nach dem Umbruch“
- Dr. Oskar Mosé: „1933 verzogen. (war verkappter Jude)“
- Simon Rotenstein: „ausgetreten: + ( Jude)“
- Dr. Bernhard Schmeidler: „ausgetreten: nach dem Umbruch“
- Hans Schregle: „ausgetreten: beim Umbruch versetzt nach Ansbach“
- Michael Vogel: „ausgetreten: bei dem Umbruch (S. P. D.)“
- Georg Lippold: „ausgetreten: 1936. ‚unter Protest‘“

Hermann O. J. Müller (1885–1945)
aus: Erlanger Tagblatt, 18. Dezember 1937 (Repro)
Stadtarchiv Erlangen
Hermann Müller kam 1929 als stellvertretender Direktor der Heil- und Pflegeanstalt nach Erlangen. Kurz darauf initiierte er sowohl die Neugründung des Kunstvereins (1930) als auch die Gründung der Erlanger Ortsgruppe des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ (1932), der das kulturelle Leben von „Schmutz und Schund“ reinigen wollte. In beiden Verbänden übte der passionierte Maler, Grafiker und Fotograf maßgeblichen Einfluss auf den Erlanger Kunstbetrieb aus. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Müller wegen seiner Verwicklung in die Krankenmorde an der Heil- und Pflegeanstalt von den US-Amerikanern verhaftet. Er nahm sich kurz darauf das Leben.
„Gesunde, kranke und entartete Kunst“, 1939
Stadtarchiv Erlangen 32.84.T.12
In mehreren Vorträgen vor dem KVE rechnete Müller mit den Kunstströmungen der Moderne ab: „Wie ein reinigendes Gewitter ist die nationalsozialistische Revolution über die deutschen Lande niedergegangen.“ Zum Thema „gesunde, kranke und entartete Kunst“ zeigte er neben Beispielen moderner Kunst auch Bilder von Psychiatrie-Patienten. Das „Erlanger Tagblatt“ berichtete: „Manche Bilder erregten lebhafte Heiterkeit, andere Bilder wieder riefen Entrüstung hervor … Bilder, die der Wirklichkeit in gar nichts nahe kommen, ja, die bei allen einigermaßen anständigen und geistig normalen Beschauern Entrüstung hervorrufen müssen.“
Ausstellungseinladung des Kunstvereins, um 1936
Stadtarchiv Erlangen, 32.84.T.12
Rund 60 Ausstellungen richtete der KVE in der NS-Zeit aus: bis 1936 noch in der Orangerie, dann im Schulhaus am Hugenottenplatz, ab 1939 schließlich im ehemaligen Haus der Freimaurerloge an der Universitätsstraße. Viele der Ausstellungen waren schlecht besucht. Laut dem Maler Willi Hilpert seien zu einer Vernissage nur elf Personen erschienen – inklusive Streichquartett.
In den Ausstellungen des KVE fand auch Propagandakunst ihren Platz: NS-Plakate von Ludwig Hohlwein, Hitler-Büsten, u. a. von Walter Bischoff, und Porträts der Führungsriege. Kritisch beurteilt wurde ein Holzschnitt von Klaus Wrage mit dem Titel „Der Führer spricht. Parteitag 1935“. Eleonore Schmidt-Herrling gab zu bedenken: „Ist hier nicht doch der Vorgang als solcher zu groß für das kleine Format?“
Künstler zwischen Linientreue, Anpassung und Verfolgung

Ernst Penzoldt (1892–1955)
Der Leser in seinen Lebensaltern, 1925
Öl auf Eternit
Das Triptychon von Ernst Penzoldt hing viele Jahre im Hausdurchgang der Buchhandlung Mencke am heutigen Hugenottenplatz. Am 29. September 1933 erschien eine Notiz in der „Fränkischen Tageszeitung“, in der die Entfernung des „bolschewistischen“ Gemäldes gefordert wurde, das ein „Ueberbleibsel aus der Zeit des alten Systems“ sei.
Einen Monat später bat der Buchhändler Max Mencke die Erlanger Ortsgruppe des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ um eine Einschätzung des Kunstwerks. Hermann Müller antwortete, dass man die Bilder „für keineswegs einwandfrei“ halte und „sie uns schon vom rein geschmacklichen Standpunkte aus an einer solch öffentlichen Stelle bedenklich erscheinen“. Entfernt wurde das Kunstwerk damals aber nicht.

Ernst Penzoldt (1892–1955)
„Zigeunerjunge“, 1937
Öl auf Leinwand
Auch während des Nationalsozialismus entstand Kunst, die nicht „regimekonform“ war – wie dieses farbenfrohe Porträt eines „Zigeunerjungen“ von Ernst Penzoldt. Ausgestellt wurden diese Werke allerdings nicht.
Walter Bischoff (1885–1945)
Johanna May, 1935
Ton
Der Bildhauer Walter Bischoff zählt zu den Erlanger Künstlern, die ihre Laufbahn nach 1933 ohne Bruch fortsetzen konnten. Bischoff erhielt in der NS-Zeit zahlreiche Aufträge, gestaltete Kriegerdenkmäler, nationalsozialistischen Bauschmuck und Hitler-Büsten. Mehrere seiner Werke waren auf den „Großen Deutschen Kunstausstellungen“ im Münchner „Haus der Deutschen Kunst“ vertreten. Daneben schuf er Arbeiten für das kunstsinnige Erlanger Bürgertum, wie etwa die Büste von Johanna May, der Ehefrau des Universitäts-Professors für Physiologie, Friedrich Julius May.

Walter Bischoff (1885–1945)
Deutschland im Krieg, 1943
Eiche
Unter den ausgebreiteten Schwingen des Reichsadlers versammeln sich Angehörige der „Volksgemeinschaft“: Im Zentrum thront, madonnenhaft, die deutsche Mutter, ein Bauernpaar und zwei Soldaten repräsentierten Nähr- und Wehrstand. Das an ein Altarbild erinnernde Holzrelief befand sich bis 1965 im Haus der christlichen Studentenverbindung Wingolfbund.
Trotz seines fortgeschrittenen Alters meldete sich Walter Bischoff 1944 zum Kriegseinsatz. Er starb 1945 in einem amerikanischen Internierungslager in Aachen.


Peter Bina (1888–1969)
Bauer, 1942
Holzschnitt
Wenngleich Peter Bina, im Unterschied zu Walter Bischoff, keine Propagandakunst im engeren Sinne schuf, entsprachen sein Stil und seine bevorzugten Sujets den ästhetischen Vorstellungen des Nationalsozialismus. Während Ernst Penzoldt oder Fritz Griebel nach 1933 ins Abseits gerieten, blieb Bina einer der meistausgestellten Erlanger Künstler. 1938 war ihm aus Anlass seines 50. Geburtstages eine Einzelschau des KVE gewidmet.
Landschaft mit Walberla, 1944
Aquarell
Die Aquarellmalerei gehörte zu Binas bevorzugten Techniken. Seine idyllischen Landschaftsbilder aus den Jahren 1944 und 1945 lassen nicht erahnen, dass zur gleichen Zeit Fliegerbomben auf das nahe Nürnberg fielen.


Hans Zahn (1929–2019)
Luftangriff, 1944
Aquarell
Das Aquarell zeigt den von der brennenden Stadt rot erleuchteten Himmel während des Luftangriffs auf Nürnberg am 31. März 1944. Der damals 15-jährige Gymnasiast Hans Zahn beobachtete das Geschehen vom Erlanger Ohmplatz aus. Später war Zahn peinlich berührt, dass er als Jugendlicher mit dem Begriff „Terrorangriff“ den Sprachduktus der Zeit kritiklos übernommen hatte.

„Entartete Kunst“
„Kulturbolschewistische Bilder“ in Mannheim
Wenige Monate nach der nationalsozialistischen Machtübernahme wurde der modernen Kunst in Deutschland der Krieg erklärt: Den Auftakt setzte im April 1933 die Kunsthalle Mannheim mit der Ausstellung „Kulturbolschewistische Bilder“, einem Vorläufer der 1937 eröffneten Wanderausstellung „Entartete Kunst“.
Die Mannheimer Schau zeigte 86 Werke von Vertretern der Moderne aus den Beständen der Kunsthalle. Sie sollte nicht nur die vermeintliche Minderwertigkeit moderner Kunst bloßstellen, sondern auch die Sammlungspolitik des kurz zuvor entlassenen Museumsdirektors Gustav Friedrich Hartlaub anprangern.
1938 erließ die NS-Regierung ein Gesetz, das die entschädigungslose Beschlagnahmung „entarteter Kunst“ legitimierte. Werke renommierter Künstler, die als „international verwertbar“ galten, verkaufte das Regime an ausländische Sammler und Museen, viele weitere Kunstwerke wurden zerstört.
Die „Mannheimer Schreckenskammer“ in Erlangen
 Werbeanzeige, 1933
Werbeanzeige, 1933
Erlanger Tagblatt, 22. Juli 1933
Stadtarchiv Erlangen
Erlanger Presseberichte über die „Schreckenskammer“-Ausstellung diffamierten die ausgestellte Kunst als „bolschewistisch“ und „volksfremd“, als „blasphemische Versündigung am Geist Albrecht Dürers“. Und dennoch blieb in der Frühphase des Regimes noch Raum für Ambivalenz, insbesondere gegenüber dem Expressionismus, dessen ideologische Einordnung höchst umstritten war. So kritisierte der Erlanger Rezensent Fritz Redenbacher, dass man Malern wie Nolde, Kirchner und Heckel Unrecht tue, wenn man sie in einer solchen Ausstellung präsentiere.
Der Tätigkeitsbericht des „Kampfbundes für deutsche Kultur“ beklagte den ausbleibenden Publikumserfolg der „Schreckenskammer“-Ausstellung und resümierte: „es zeigte sich …, dass die Teilnahme am kulturellen Leben auch in den nat.soz. Kreisen noch recht gering ist und dass noch viel Arbeit zu leisten sein wird, um die Bedeutung des kulturellen Lebens diesen Kreisen einzuhämmern.“
Der Kunstverein unter dem Vorsitz Hermann Müllers brachte bereits im Juli 1933 eine Auswahl der Mannheimer Schau nach Erlangen. Dort war sie unter dem Titel „Mannheimer Schreckenskammer“ in der Orangerie ausgestellt. Die Liste der vertretenen Künstler liest sich wie ein „Who’s Who“ der Moderne: Max Beckmann, Marc Chagall, Robert Delaunay, Otto Dix, George Grosz, Erich Heckel, Alexej von Jawlensky, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Emil Nolde, Oskar Schlemmer …
Es war die wohl „hochkarätigste“ Ausstellung, die je in Erlangen zu sehen war. Schon 1933 habe mancher Kunstfreund hinter vorgehaltener Hand ironisch von „Dr. Müller’s bester Ausstellung“ gesprochen. Aus den zeitgenössischen Quellen geht allenfalls hervor, dass die Besucherzahl weit hinter den Erwartungen zurückblieb.
Ein Spezifikum der Erlanger Ausstellung war der Vergleich von moderner Malerei mit Kunstwerken von Psychiatriepatienten – womöglich aus der Erlanger Heil- und Pflegeanstalt, die unter Müllers Leitung stand. Es war die wohl früheste Gegenüberstellung dieser Art. In späteren „Schandausstellungen“ wurde der Gegensatz von „gesunder“ und „geisteskranker“ Kunst auf ähnliche Weise propagiert.
Viele der in Mannheim und Erlangen gezeigten Werke waren ab 1937 auch in der Wanderausstellung „Entartete Kunst“ zu sehen. Heute hängen die meisten in den großen Museen der Welt, in New York, Madrid und Basel. Manche wurden von den Nationalsozialisten zerstört, einige gelten als verschollen.
Zum vorherigen Kapitel (Moderne Kunst in Krisenzeiten)
Zur Übersicht
Zum nächsten Kapitel (Kunstszene im Aufbruch)