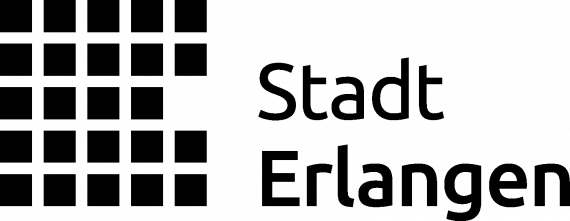Kunstszene im Aufbruch
Im Unterschied zu anderen deutschen Städten war Erlangen bei Kriegsende weitgehend unversehrt. Auch deshalb zog die Stadt in der unmittelbaren Nachkriegszeit viele heimatlos gewordene Künstler an: „Ausgebombte“, ehemalige Kriegsgefangene und Geflüchtete aus den Ostgebieten. Viele von ihnen, wie Helmut Lederer, Oskar Johannes Stanik oder Lothar Strauch, sollten das lokale Kunstleben über Jahrzehnte prägen.
Der Kulturbetrieb lebte rasch wieder auf. Bis zur Wiedergründung des Kunstvereins 1950 bestand ein Nebeneinander verschiedener Institutionen und Gruppen, die mit etlichen Ausstellungen an die Öffentlichkeit traten, darunter die wohl erste Nachkriegsausstellung in der westlichen Besatzungszone.
Der Nachholbedarf war immens. Kunstschaffende und Publikum waren bestrebt, Anschluss an internationale Entwicklungen und moderne Strömungen zu finden. Kunstwerke fanden einen nie dagewesenen Absatz – auch als krisensichere Wertanlage. Mit der Währungsreform änderte sich dies abrupt, da das Kaufinteresse nun anderen Konsumgütern galt. Viele Künstlerinnen und Künstler mussten sich daher einen zusätzlichen Broterwerb suchen.
„Über Nacht wurde Erlangen
zu einem Eldorado der Kunst.“
(Christian Kazner, Vorsitzender
des Kunstvereins Erlangen, 1964)

Plakat der Erlanger Herbstausstellung, 1945
Stadtarchiv Erlangen 75.A3.81
Bereits für September 1945 erteilte die US-Militärregierung die Erlaubnis zur Durchführung einer Kunstausstellung in Erlangen. Vermutlich war die Herbstausstellung im Pathologischen Institut sogar die erste Nachkriegsausstellung auf dem Gebiet der späteren Bundesrepublik. Organisiert wurde sie von dem Künstler Hermann Wilhelm, der vor 1945 in Berlin und Nürnberg lebte und arbeitete. Erlangen war ihm jedoch seit seiner Jugend vertraut, er nannte es seine zweite Heimat. In Nürnberg ausgebombt – wobei fast sein gesamtes Frühwerk verloren ging –, ließ Wilhelm sich nach Kriegsende für einige Jahre in Erlangen nieder, wo er einer der „Motoren“ des Kunstlebens wurde.

Hermann Wilhelm, Jakob Dietz, Christian Klaiber, 1947
Fotografie
Stadtarchiv Erlangen 32.84.T.31

Oskar Stanik mit Entwürfen zu einer Gedenkbriefmarke für Kriegsgefangene, 1952
Foto: Rudi Stümpel
Stadtarchiv Erlangen VIII.7268.N.1/1
Der aus Ostpreußen stammende Oskar Stanik kam 1949 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Erlangen, wo er bis zu seinem Tod 1981 als Maler wirkte. Zeitlebens fiel es ihm schwer, sich als Künstler über Wasser zu halten. Dies gelang ihm vorwiegend durch Auftragsarbeiten für den öffentlichen Raum sowie als Werbe- und Gebrauchsgrafiker.

Helmut Lederer, 1952
Foto: Rudi Stümpel
Stadtarchiv Erlangen VIII.7260.N.3/6
Helmut Lederer ist in seiner Bedeutung für das Erlanger Kunstleben nach 1945 kaum zu überschätzen. In Eger geboren, studierte er an den Kunstakademien in Wien und Florenz und war als Filmfotograf und Kameraassistent in Prag tätig. 1945 floh er nach Erlangen, wo er ein Atelier in der Loschgestraße bezog. Er trat als vielseitig begabter, auch international anerkannter Bildhauer, Zeichner und Fotograf hervor. Als Grafikdesigner von Rang gestaltete er über Jahrzehnte die Zeitschrift „das neue erlangen“. Im Erlanger Stadtbild ist er mit einer Vielzahl von Plastiken, Mosaiken und Wandbildern präsent.
Verschiedene Künstler – verschiedene Welten
So verschieden die Künstlernaturen waren, die der Zufall in Erlangen zusammenbrachte, so unterschiedlich waren auch die Motive und Ausdrucksweisen ihrer Kunst. Da waren diejenigen, die ihrem Stil ungeachtet aller politischen Umbrüche treu blieben. Andere hingegen durften nach langjährigem Verbot erstmals wieder ausstellen und sich den vorher verfemten Stilrichtungen widmen.
Die Werke aus den späten 1940er Jahren decken ein dementsprechend weites Spektrum ab, das von Landschaftsdarstellungen über die Verarbeitung von Eindrücken der Kriegs- und Nachkriegszeit bis hin zu religiösen Sujets reicht.

Friedrich Herlt (1914–2010)
Hungerzeit-Bild, 1945
Öl auf Karton
Friedrich Herlt, im heutigen Libina/Tschechien geboren, absolvierte von 1945 bis 1949 eine Facharztausbildung in Erlangen. Schon als Student hatte er Malunterricht genommen und sich in seiner Freizeit künstlerisch betätigt. Viele seiner Nachkriegswerke spiegeln die Not dieser Jahre wider.

Oskar Johannes Stanik (1921–1989)
Straße der Verdammten, 1949
Öl auf Leinwand und Faserplatte
Stanik schuf dieses Gemälde, das eine Gruppe deutscher Soldaten auf dem Weg in die Kriegsgefangenschaft zeigt, unter dem Eindruck seiner eigenen Erfahrungen in sowjetischer Gefangenschaft.

Joseph Albert Hirtz (1911–1955)
Porträt eines GI, 1947
Öl auf Leinwand
Der 1911 in Erlangen geborene Hirtz blieb bis zu seinem frühen Tod 1955 in seiner Heimatstadt, wo er sich an mehreren Nachkriegsausstellungen beteiligte. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als freischaffender Maler und Grafiker. Bei dem hier porträtierten Soldaten handelt es sich wohl um einen Angehörigen der ab 1945 in Erlangen stationierten US-Armee.
Peter Bina (1888–1969)
Blick von Marloffstein nach Westen, 1946
Aquarell auf Karton
Landschaften waren eines der bevorzugten Motive des in Fürth geborenen Peter Bina, an dem er, anscheinend unbeeindruckt von den Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs, festhielt. Schon in der NS-Zeit wohlgelitten, war er auch nach 1945 weiterhin als Maler gefragt. Die Militärregierung berief Bina in einen Ausschuss für bildende Kunst; daneben lehrte er weiterhin als Kunstlehrer am Gymnasium Fridericianum.

Jakob Dietz (1889–1960)
Haus hinter Bäumen, 1949
Öl auf Leinwand
Anders als Bina erfuhr der seit 1924 in Nürnberg lebende Dietz breite künstlerische Anerkennung erst nach dem Ende der NS-Herrschaft. Im Stil des expressiven Realismus hielt er Landschaften, städtebauliche Veränderungen und – wie hier – interessante Bauensembles fest.

Christian Klaiber (1892–1963)
Landschaft, 1947
Öl auf Karton
Christian Klaiber, der insgesamt fast 30 Jahre in Erlangen lebte, widmete sich immer wieder intensiven Naturstudien. Da er sich der NS-Kunstdoktrin verweigert hatte, stand er im „Dritten Reich“ unter Beobachtung der Gestapo. 1937 gewährte ihm sein enger Freund, der spätere KVE-Vorsitzende Christian Kazner, einige Monate Asyl in seiner Wohnung. Seine erste größere Ausstellung hatte Klaiber 1947 in Erlangen. Sie wurde zu einem durchschlagenden Erfolg und machte ihn mit einem Mal überregional bekannt.


Paul Plontke (1884–1966)
Christus, um 1946
Öl auf Leinwand
Plontke war schon vor dem Zweiten Weltkrieg ein angesehener Künstler. Seit 1920 lehrte er an der Hochschule für bildende Künste in Berlin, wo Hermann Wilhelm zu seinen Schülern zählte. Im Februar 1945 flüchtete er über Erlangen nach Kramsach/Tirol. Der befreundete katholische Stadtpfarrer Eugen Buck überredete ihn jedoch zur Rückkehr in die Hugenottenstadt. Auf seine Veranlassung schuf Plontke ab 1946 die umfangreiche Gemäldeausstattung der Erlanger Herz-Jesu-Kirche. Der gläubige Katholik knüpfte dabei auch stilistisch an frühere Arbeiten als Kirchenmaler an.

Lothar Strauch (1907–1991)
Männlicher Torso, 1946–47
Gips
Strauch, einer der bedeutendsten Erlanger Bildhauer der Nachkriegszeit, stammte aus Stuttgart und hatte in Berlin studiert. Nach Erlangen kam er 1945 als Verwundeter und entschloss sich, hier einen Neubeginn zu wagen. Wie viele Künstler hatte er infolge des Krieges den Verlust seines Ateliers zu beklagen. In Erlangen ist er durch zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum bekannt. Bei dem Torso handelt es sich vermutlich um eine Studie für die Darstellung eines Gekreuzigten. Nach Kriegsende schuf Strauch im Auftrag Erlanger Kirchengemeinden mehrere sakrale Werke, die ansonsten in seinem Schaffen nur eine geringe Rolle spielen.

Herbert Martius (1924–2009)
„Kriegsleporello“, 1943/44
Aquarell/Wassermalfarben, Tusche
Privatbesitz
Martius zählt zu den innovativsten Erlanger Künstlerpersönlichkeiten. Nach Kriegsdienst und sowjetischer Gefangenschaft kehrte er 1949 in seine Geburtsstadt Erlangen zurück und wirkte hier bis zu seinem Tod als freischaffender Künstler. Er hinterließ ein umfangreiches Œuvre als Maler und Grafiker, betätigte sich aber auch auf dem Gebiet der Plastik und Keramik. Seine höchste Ausdrucksform erreichte er mit Emaille. Die verschiedenen Techniken hatte er sich im Selbststudium erarbeitet. Das aus 31 zusammengeklebten Einzelblättern bestehende und insgesamt ca. 6,5 Meter lange „Kriegsleporello“ entstand wohl während der Belagerung von Leningrad.
Gesamtansicht des Leporellos (Video)

Otto Meister (1892–1959)
Anfechtungen eines Künstlers, 1947
Öl auf Rupfen
Otto Meister gehört ebenfalls zu den Künstlern, die nach dem Krieg Zuflucht in Erlangen fanden. In Dresden geboren, war sein Schaffen durch den Expressionismus der dort gegründeten Künstlergruppe „Brücke“ geprägt. 1934 erhielt er Berufsverbot, wurde jedoch ab 1942 als Kriegsmaler eingesetzt. Sein Dresdner Atelier und alle dort gelagerten Werke wurden 1945 vernichtet.
In Erlangen fand Meister rasch Anschluss an die hiesige Künstlerschaft und war an der ersten Nachkriegsausstellung beteiligt. Die Gespenster der Vergangenheit aber blieben lange präsent: Das Gemälde verweist durch eine Fülle von Motiven und Allegorien auf Krieg, Zerstörung und Vergänglichkeit.

 Christian Kazner (1893–1971)
Christian Kazner (1893–1971)
Ölgemälde von Oskar Johannes Stanik, 1959
Der Zahnarzt Christian Kazner hatte bereits 1944 eine führende Stellung im KVE übernommen. Als unbelastet geltend, wurde er 1950 einer der Initiatoren des neuen Kunstvereins und übernahm bis 1962 dessen Vorsitz. Kazner pflegte ein elitäres Kunstverständnis. Er schätzte die Malerei der Moderne, reine Abstraktion lehnte er jedoch ab. Sein oft selbstherrliches, beinahe diktatorisches Auftreten gab immer wieder Anlass zur Kritik. Den Kunstverein sah er – im Gegensatz zu den Vorstellungen Paul Ungers – weniger als Interessensvertreter der Künstlerschaft, denn als bürgerlichen Kunstliebhaberverein mit Autorität im Geschmacksurteil.
Der Kunstverein gründet sich neu
1950 kam es nach mehreren gescheiterten Anläufen zur Wiedergründung des Kunstvereins, der nach Kriegsende durch die US-Besatzer aufgelöst worden war. Unter dem Einfluss des Hobbykünstlers Paul Unger verschob sich der programmatische Akzent: Die Interessen der Kunstschaffenden wurden nun stärker betont, auch wollte man sich modernen Kunstströmungen öffnen – zumindest nach verbalen Bekundungen.
Um vor der Besatzungsmacht zu bestehen, berief sich der Verein auf eine vorgeblich unbelastete Tradition, nämlich die innovativen Erlanger Ausstellungen der frühen 1920er Jahre, die mit dem damaligen Kunstverein jedoch nur am Rande zu tun hatten. Die Nähe des Vorgängervereins zur NS-Ideologie wurde dagegen stillschweigend übergangen.
Eine „Stunde Null“ gab es nicht: Mit Christian Kazner übernahm ein Repräsentant der Vorgängerinstitution den Vorsitz, viele frühere Mitglieder waren auch im neuen Verein vertreten, altes Gedankengut überdauerte bis in die Nachkriegszeit, Konflikte zwischen konservativem und zukunftsgerichtetem Kunstverständnis blieben dabei nicht aus.

Die wachsende Stadt als Motiv
Nach Kriegsende nahm Erlangen einen beachtlichen Aufschwung, begleitet von einer regen Bautätigkeit. Wesentlichen Anteil hatte daran die Ansiedlung der Berliner Siemens-Schuckert-Werke (SSW). Die neuen Mitarbeiter und deren Familien mussten untergebracht werden. Mit dem Werkswohnungsbau der SSW dehnte sich die Stadt vor allem in Richtung Süden aus. Dort entstanden auch die neuen Verwaltungsbauten des Konzerns, der „Himbeerpalast“ (1948/53) und der „Glaspalast“ (1959/62). Die barocke Stadtsilhouette wurde nun von Hochhäusern überragt, die dem Stadtbild durch neue Bauformen und Materialien ein modernes Gepräge gaben.
Mehrere lokale Künstler haben diese Bautätigkeit, mit der Erlangen die kleinstädtische Beschaulichkeit allmählich hinter sich ließ, in ihren Werken festgehalten. Die eindrucksvollen Großbaustellen mit ihren Aufzugschächten, Stahlskeletten und Baukränen besaßen durch ihren urbanen Charakter einen besonderen Reiz, manche der Werke entstanden wohl als Auftragsarbeiten.
„Kaum war der Grundstein zur Industriestadt Erlangen gelegt, als schon diese sich mit einem bemerkenswerten Elan zur Kunststatt bekannte.“
(Herbert Paulus, 1954)

Joseph Albert Hirtz (1911–1955)
Siemens-Baugrube, um 1950
Öl auf Leinwand
Hier fällt nicht nur das ungewöhnliche Motiv einer Baugrube auf, sondern auch die Art der Darstellung. Große, farbige, kubistisch anmutende Flächen erzielen durch geschickte Anordnung und Farbkontraste den Eindruck räumlicher Tiefe. Dargestellt ist vermutlich die Baustelle des „Himbeerpalastes“.

Bernhard Postner (1924–1998)
Siemens-Hochhaus („Glaspalast“), 1960
Tusche
Der gebürtige Erlanger Bernhard Postner, der wie viele seiner Generation als Soldat in Kriegsgefangenschaft geriet, studierte von 1949 bis 1952 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Er war einer der wenigen, die eine Existenz als freischaffender Künstler durchhielten, nur kurzzeitig war er auch als Kunsterzieher tätig. Er schuf zahlreiche Konzert- und Theaterzeichnungen für das „Erlanger Tagblatt“ und hielt, wie hier, unzählige Erlanger Motive fest.

Oskar Johannes Stanik (1921–1989)
Im Bau („Himbeerpalast“), 1952
Aquarell
Auch Oskar Stanik malte die neuen, für Erlanger Verhältnisse spektakulären Siemens-Gebäude noch in der Bauphase. Das Bild war, wie auch die Tusche-Zeichnung von Bernhard Postner, Teil der regionalen Siemens-Kunstsammlung, die 2021 aufgelöst wurde.

Oskar Johannes Stanik (1921–1989)
Siemens-Neubau („Glaspalast“), 1960
Öl auf Leinwand

Otto Grau (1913–1981)
Siemens-Verwaltungsbau („Glaspalast“), 1961
Öl auf Leinwand
Im Werk Otto Graus bildet die Auseinandersetzung mit seiner Heimatstadt einen wesentlichen Aspekt, und auch bei ihm ist der entstehende „Glaspalast“ ein Thema. Dies zeigt, wie eindrucksvoll der Wandel Erlangens in der Nachkriegszeit empfunden wurde.

Oskar Johannes Stanik (1921–1989)
Bau der Autobahnbrücke bei Frauenaurach, 1961
Öl auf Hartfaserplatte
Nicht nur Erlangen wuchs nach dem Zweiten Weltkrieg rasant: Auch die Einwohnerzahl Frauenaurachs, das erst 1972 eingemeindet wurde, stieg sprunghaft an, vor allem durch den Zuzug von Flüchtlingen. Wirtschaftlichen Aufschwung brachte Anfang der 1960er Jahre der Bau des Großkraftwerks Franken II und eines Gewerbegebiets mit Anschluss an die Autobahn A 3. Insofern steht auch der hier festgehaltene Bau der Autobahnbrücke für die außerordentliche Expansion Erlangens nach 1945.