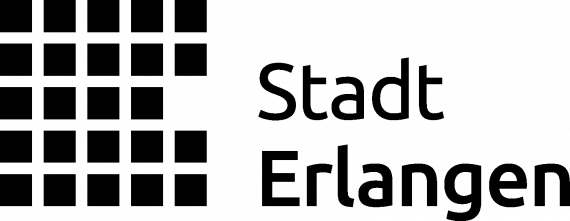Influencer
Manche Wörter aus fremden Sprachen sind außergewöhnlich produktiv. Wie sich ein eingewandertes Strategiespiel zum festen Bestandteil der mittelalterlichen Hofkultur entwickelte und zahlreiche neue Wörter hervorbrachte, zeigt das Beispiel Schach.
Sie haben die Einwilligung zur Nutzung von Videos auf dieser Website noch nicht erteilt.

 Schachfiguren,
Schachfiguren,
Anfang 19. Jahrhundert
Schach
Dem Schachspiel verdankt unsere Sprache Redensarten wie „jemanden in Schach halten“, „eine Rochade vornehmen“ oder „Patt-Situation“.
 Kühltier „Kuh“ von Baby-Frank
Kühltier „Kuh“ von Baby-Frank
Erlangen-Tennenlohe, um 2020
Schecke
Nach den abwechselnd schwarzen und weißen Schachfeldern nennt man seit knapp tausend Jahren auch schwarzweißes oder schwarzbraunes Fleckvieh, vor allem Pferde, scheckig oder Schecke. Ursprung sind die französischen Bezeichnungen für das Schach und die Schachfiguren: „eschas“ und „eschecs“.
 Ehemaliger Checkpoint am Gate der Ferris Barracks
Ehemaliger Checkpoint am Gate der Ferris Barracks
Fotograf: Rudi Stümpel, 1970
Stadtarchiv Erlangen, VIII.3213.N.3/7
Checkpoint
Bei Bedrohung des Herrschers riefen die Araber die Warnung „sah“ oder „as-sah“. Das findet sich ähnlich im Altfranzösischen als „echecs“. Im Englischen wurde daraus „chess“ für das Spiel und „check“ für den Warnruf. Da der Herrscher damit quasi gestoppt wurde, entwickelte sich „check“ zu einem Wort für abruptes Aufhalten. Das kam an Kontrollpunkten für Reisende vor, die man später „check point“ nannte. Daraus entwickelte sich der moderne Checkpoint sowie der Check-in, das Einchecken und das Durchchecken.
 Scheck der Baumwollspinnerei Erlangen
Scheck der Baumwollspinnerei Erlangen
Wangen, 1923
Scheck
Im 16. Jahrhundert hatte sich „check" im Englischen als Begriff für Kontrollpunkte und Kontrollzeichen etabliert. Kurz nach ihrer Gründung 1694 führte die Bank of England den „cheque" ein. Das war eine Zahlungsanweisung mit einem Kontrollabschnitt, der gecheckt wurde. Spätestens Anfang des 19. Jahrhundert hieß dann die Zahlungsanweisung selbst so. Und in eben dieser Zeit übernahmen Deutsche das Wort als Scheck.

Bodycheck und Crosscheck
Anfang des 20. Jahrhunderts tauchte im Englischen zum ersten Mal „bodycheck“ („Körperhindernis“) auf. Gemeint war das abrupte Aufhalten eines Gegenspielers im Sport durch Einsatz des eigenen Körpers. In verschiedenen Sportarten, vor allem aber im Eishockey, hat sich der Begriff international durchgesetzt.
Während Bodychecks im Eishockey erlaubt sind, sind Crosschecks – der Einsatz des Schlägers zur Abwehr des Gegners, bei dem der Spieler den Schaft des Schlägers mit beiden Händen festhält und kein Teil des Schlägers den Boden berührt – verboten. Der Spieler hält dabei seinen Schläger quer (englisch: „cross“) zum eigenen Körper.

Checker
Das Checken im Sinne von „Kontrollieren“ wurde bald auf alle möglichen Untersuchungen bis hin zum Gesundheitscheck übertragen. Wer genau checkt, erweist sich als findig, klug, manchmal genial. So entstand der Ausdruck Checker für jemanden, der gewitzt ist und schnell begreift.