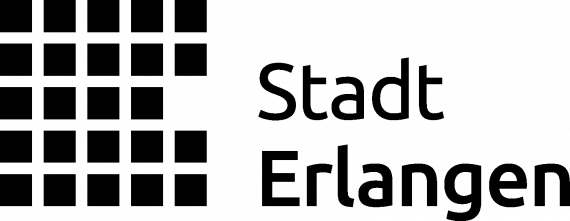Missverstandene
Sogenannte Volksetymologien beruhen auf einem Missverständnis, das entsteht, wenn das „einfache Volk“ mit einem fremden Wort wenig anfangen kann. Im Lauf der Zeit wird es daher so lange umgeformt und umgedeutet, bis es einem vertrauten Vorbild ähnelt. Die ursprüngliche Bedeutung geht dabei oft verloren.
Sie haben die Einwilligung zur Nutzung von Videos auf dieser Website noch nicht erteilt.
 Vielfraß-Präparat
Vielfraß-Präparat
20. Jahrhundert
Stadt Hof, Museum Bayerisches Vogtland
Vielfraß
Dieses Tier war in seiner skandinavischen Heimat als fjeldvross bekannt. Zu seinem deutschen Namen Vielfraß kam es wohl durch eine Umdeutung der norwegischen Bezeichnung durch deutsche Kaufleute.
Weitere Missverstandene ...

Schmetterling
Im Ostsächsischen gab es schon im 16. Jahrhundert viele sprachliche Anleihen beim tschechischen Nachbarn. So bezeichnete man Rahm damals als „Schmetten“, nach dem tschechischen „smetana“. Der Tiername „Schmetterling“ verweist auf einen alten Volksglauben, demzufolge dieses Insekt in das Haus eindringe, um Milch und Sahne zu stehlen. Das erklärt auch den englischen Namen „butterfly“. Mit dem deutschen Verb „schmettern“ hat der Schmetterling nichts zu tun.

Tollpatsch
In seiner Ursprungssprache, dem Ungarischen, bezeichnete „talpas“ (füßig, breitfüßig) ab dem 17. Jahrhundert einfache Fußsoldaten, vermutlich wegen ihrer breiten Sohlen. Im Österreichischen entwickelte sich das Wort zu einem Spottnamen für Soldaten ungarischer Herkunft und meinte schließlich allgemein einen ungeschickten Menschen. Mit den deutschen Wörtern „toll“ und „patschen“ hat der Tollpatsch also nichts zu tun, auch wenn man ihn seit der Rechtschreibreform von 1996 mit Doppel-l schreibt.

Amtsschimmel
Woher der Amtsschimmel seinen Namen hat, ist nicht ganz klar. Eine Theorie vermutet seinen Ursprung in der Bürokratie der österreichischen Monarchie. Dort bezeichnete der Begriff „Simile“ (lateinisch „similis“ = ähnlich) ein Standardformular, mit dem sich ähnliche Vorgänge bearbeiten ließen. Wenn ein Beamter stets nach „Schema F“ handelte und auf den Mustervorlagen „herumritt“, galt er als „Simile-Reiter“ bzw. „Schimmel-Reiter“. Von dort war es bis zum Amtsschimmel nur noch ein kurzer Weg.

unter aller Kanone
Hier werden nur scheinbar schwere Geschütze aufgefahren, denn mit „Kanone“ ist nicht die Feuerwaffe, sondern das lateinische „canon“ gemeint, das so viel wie „Richtschnur“ oder „Regel“ bedeutet – man denke an das kanonische Kirchenrecht oder den Literaturkanon. Ist etwas unter aller Kanone, verstößt es also gegen sämtliche Regeln.

einen Kater haben
Wer an einem Katarrh (griechisch „katarrhein“ = herunterfließen) erkrankt, leidet unter einer akuten Entzündung der Nasenschleimhäute. Ganz andere, aber ähnlich unangenehme Symptome stellen sich nach übermäßigem Alkoholkonsum ein. Vermutlich waren es Studenten des 19. Jahrhunderts, die nach dem Vorbild des „Katarrhs“ einen neuen Krankheitsbegriff schufen: den Kater.