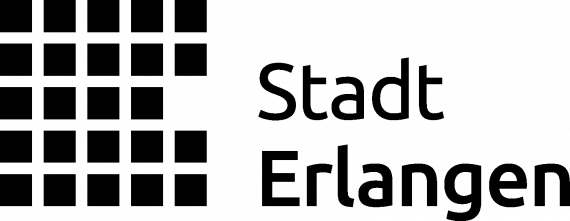Gegenständlich versus Abstrakt
Während die gesellschaftlichen Strukturen der 1950er Jahre im konservativen Denken der Adenauer-Zeit verharrten, setzten sich in der Kunst zunehmend neue Ausdrucksformen durch oder wurden nach Jahren der Diktatur wiederentdeckt. Insbesondere die abstrakte Kunst fand zahlreiche Anhänger: Sie galt als unbelastete, scheinbar unpolitische und international verständliche „Weltsprache“.
In Erlangen machte sich die moderne Abstrakte, vermittelt durch Ausstellungen des Gemeinnützigen Vereins, nur mit Verzögerung bemerkbar und stieß beim Publikum, aber auch bei manchen Künstlern auf Widerstand.
Die deutschlandweit geführte Debatte über den Wert gegenstandsloser Kunst hatte auch eine ideologische Komponente: Abstrakte Malerei wurde als antikommunistischer, freiheitlicher Gegenpol zum staatlich verordneten „sozialistischen Realismus“ verstanden, der in der DDR bestimmend war.
„Gegenstandslose Malerei will das Sinnlose gestalten
oder ist zu schwach, einen Sinn zu vermitteln.“
(Willi Hilpert, 1950)
„Das Klima für moderne Malerei ist in Franken nicht günstig.
Die öffentlichen Aufträge sind rar und Konventionelles wird bevorzugt.“
(Walter Zimmermann)

Plakat der Ausstellung „Baumgärtel, Koller, Lederer, Martius, Zimmermann“, 1959
Entwurf: Helmut Lederer
Kunstmuseum Erlangen
Mit Gerhard Baumgärtel, Helmut Lederer, Herbert Martius, Oskar Koller und Walter Zimmermann sind die Künstler genannt, die sich in Erlangen am engagiertesten der Moderne verschrieben. Obwohl in ihrer künstlerischen Aussage sehr unterschiedlich, machte diese Gruppe zwischen 1959 und 1988 mit vier gemeinsamen Ausstellungen in der Orangerie von sich reden.

Gerhard Baumgärtel (1924–1984)
Abstrakte Komposition, 1966
Öl und Acryl auf Leinwand
Gerhard Baumgärtel, ein Schüler Hermann Wilhelms, war 1944 nach Erlangen gekommen, wo er bis 1950 lebte. In der Region gehörte er zu den ersten Malern, die nach dem Zweiten Weltkrieg die deutsche Isolation durchbrachen und Anschluss an den Informel in Frankreich und den USA suchten. Er gilt hier als einer der frühen Tachisten, die durch spontanen Farbauftrag unbewusste Empfindungen darstellen wollten. Die Komposition wirkt ungezwungen, beruht jedoch auf dem wohlkalkulierten Einsatz von Farbe und Techniken.

Oskar Koller (1925–2004)
Landschaft, 1960
Aquarell und Tusche
Oskar Koller kann als einer der führenden Vertreter der bildenden Kunst in Nordbayern angesehen werden. Obwohl er seit den 1950er Jahren als freischaffender Künstler in Nürnberg lebte, wo er auch seine Ausbildung absolviert hatte, blieb er seiner Geburtsstadt Erlangen stets verbunden. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt er 1983 den Kulturpreis der Stadt Erlangen. Etwa ab 1957 wandte er sich der Abstraktion zu und erreichte vor allem mit seinen Aquarellen, bei denen Landschaften, Bäume, Menschen und nicht zuletzt Blumen zu seinen bevorzugten Motiven zählten, überregionales Ansehen.

Helmut Lederer (1919–1999)
Hemdauszieherin, nach 1954
Bronze
Formengruppe, nach 1960
Bronze
Frauenakte und weibliche Formen nehmen im bildhauerischen Schaffen Helmut Lederers großen Raum ein. Während die Darstellung hier noch weitgehend gegenständlich ist, zeichnet sich das spätere Werk durch eine abstrahierte Formensprache aus, wie sie in der „Formengruppe“ bereits erkennbar ist.

Herbert Martius (1924–2009)
Kirschgarten, undatiert
Aquarell
Mit dem Aquarell aus dem Zyklus „Kirschgarten“ griff Martius ein populäres Bildmotiv auf, brach jedoch mit der romantisierenden Darstellungskonvention. Die blühenden Bäume sind auf ihre Grundformen reduziert, erscheinen aber dennoch wirklichkeitsnah.

Walter Zimmermann (1920–2002)
Schießbude, 1956
Öl auf Leinwand
Subkultur, 1958
Öl auf Leinwand
Walter Zimmermann, der aus dem Raum Wuppertal stammte, folgte 1955 seiner Ehefrau Erika Zimmermann nach Erlangen, die hier im Schuldienst tätig war. Anfangs noch der Gegenständlichkeit verpflichtet, wandte er sich ab 1957 der reinen Abstraktion und dem Farbexperiment zu. Die Titel dieser Gemälde legten der Maler und seine Frau nachträglich fest. Da der Erfolg auf dem Kunstmarkt ausblieb, trat Zimmermann eine Stelle als Kunsterzieher an.

Willi Hilpert (1909–1986)
Landschaft und Häuser, 1958
Aquarell
Willi Hilpert, der sein ganzes Leben in Erlangen verbrachte, war seit 1937 mit Darstellungen der fränkischen Landschaft in Ausstellungen vertreten. Diesem Motivkreis blieb er auch in der Nachkriegszeit treu und widersetzte sich allen modernen Strömungen. Den Aufbau des Erlanger Kulturlebens ab 1945 gestaltete er entscheidend mit und wurde dafür 1981 mit dem Kulturpreis der Stadt Erlangen ausgezeichnet.

Hermann Wilhelm (1897–1970)
Blumen, 1958
Öltempera auf Karton
Aus demselben Jahr wie Hilperts Landschaftsbild stammt dieses Werk Hermann Wilhelms, eine abstrakte Komposition, der das verbreitete Blumen-Motiv zugrunde liegt.

Otto Grau (1913–1981)
Markt, um 1955
Öl auf Leinwand
Unmittelbar nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1946 schaltete sich der gebürtige Erlanger Otto Grau ins Kunstleben seiner Heimatstadt ein und gehörte bis zu seinem Tod zu dessen prägendsten Persönlichkeiten, sowohl als freischaffender Künstler als auch im Schuldienst. Seit 1993 verleiht die Otto-und-Hildegard-Grau-Kulturstiftung alle zwei Jahre den Otto-Grau-Kulturpreis an eine fränkische Künstlerpersönlichkeit. Hatte Otto Grau zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn noch naturalistisch und gegenständlich gemalt, trat er später auch mit Beiträgen zur abstrakten Kunst hervor, was sich in dieser flächenhaft gestalteten Marktszene bereits andeutet.

Otto Grau (1913–1981)
Figur, 1976
Bleistift und Acryl auf Karton
Die flächig-abstrahierende Malweise kommt in dieser gut 20 Jahre nach dem Gemälde „Markt“ entstandenen Darstellung einer weiblichen Figur noch stärker zum Tragen. Die Gesichtsdarstellung ist durch den Kubismus Picassos beeinflusst, einer damals bereits 70 Jahre alten Stilrichtung.

Hans Gügel (1907–1990)
Seher, 1967
Ton
Gügel, der aus der Nähe von Forchheim stammte, besuchte in Erlangen das Gymnasium und studierte in Nürnberg und München. Die Einberufung zum Kriegsdienst vereitelte seinen Versuch, sich in München als freischaffender Künstler niederzulassen. Nach 1945 lebte Gügel zunächst in Frauenaurach, ab 1959 in Erlangen. Er war Mitinitiator des 1950 wiedergegründeten Kunstvereins, ab 1949 zudem „Art instructor“ bei der US-Armee. Als Kunstpädagoge unterrichtete er 30 Jahre lang an der VHS sowie an der Werner-von- Siemens-Realschule.

Stifterpaar, 1972
Ton
Die menschliche Figur steht bei Gügels bildhauerischer Arbeit im Mittelpunkt. Die Schwelle zur abstrakten Kunst überschreitet er dabei nicht, doch werden die Darstellungen häufig auf das Wesentliche reduziert, mit Anklängen an gotische Skulpturen und das Werk Ernst Barlachs.

Christian Wrede (1896–1971)
Wasserträgerin, um 1960
Gips
Der Bildhauer Christian Wrede stammte zwar aus Erlangen, verbrachte aber die meiste Zeit seines Lebens in München. Wie viele seiner Berufsgenossen verlor er im Krieg Wohnung und Besitz. Von 1945 bis 1950 lebte er daher wieder in seiner Heimatstadt und beteiligte sich rege an der Wiederbelebung des Kunstbetriebs. Zunehmend öffnete er sich neueren Strömungen, wie vor allem die stilisierte Wasserträgerin vor Augen führt.