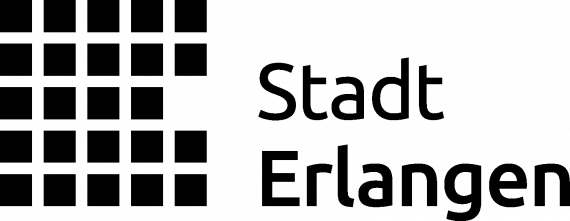Vom „Moment“ zum „Augenblick“. Eingedeutschte Fremdwörter
In der Barockzeit entstanden Sprachgesellschaften, die sich die Pflege und Aufwertung der deutschen Sprache zur Aufgabe machten. Zu den bekanntesten gehören noch heute die Fruchtbringende Gesellschaft in Köthen (1617) und der Pegnesische Blumenorden in Nürnberg (1644).
Um den Wert ihrer Muttersprache aufzuzeigen, verfassten die Gelehrten theoretische Abhandlungen und inventarisierten die deutsche Sprache in Wörterbüchern. Zur Sprachpflege gehörte die „Reinigung“ des Deutschen von dialektalen und umgangssprachlichen Einflüssen. Auch der übermäßige Fremdwortgebrauch, das „Alamodewesen“ und die vermeintliche „Fremdgierigkeit“ der Deutschen waren Gegenstand beißender Satiren. Dennoch blieb der Ton gemäßigt. Bestimmend war der Wunsch nach einer allgemeinverständlichen Sprache mit einheitlichen Regeln – ganz im Sinne der Aufklärung.
Im Mittelpunkt standen damals Bemühungen, unliebsame Fremdwörter zu „verdeutschen“. Während viele der künstlichen Neuschöpfungen als grotesk empfunden wurden, gingen manche Vorschläge in den Sprachgebrauch ein und werden ganz selbstverständlich genutzt. So existiert heute der Moment neben dem „Augenblick“, die Bibliothek neben der „Bücherei“ und die „Mundart“ neben dem Dialekt.

Eindeutschungen

Erraten Sie, welche bekannten Fremdwörter sich hinter den Eindeutschungen verbergen?
- Meuchelpuffer
- Brockenschmaus
- Füllplätzchen
- Klappstüllchen
- Gesichtspinselei
- Mummengesicht
- Dörrleiche
- Krachklappern
- Auftragebrett
- Stäubung
- Gesichtserker
 Johann Michael Moscherosch
Johann Michael Moscherosch
Ein schön new Lied genannt Der Teutsche Michel (Repro) Flugblatt, 1642
© Bayerische Staatsbibliothek
„Der Teutsche Michel“
Der Dichter und Satiriker Johann Michael Moscherosch (1601–1669) richtet sich in seinem Klagelied des „Teutschen Michel“ gegen „Sprachverderber“ der Alamodezeit. Selbst einfache Schneider und Mägde würden das Deutsche durch übermäßigen Fremdwortgebrauch verunstalten:
„Ich teutscher Michel / versteh schier nichel / In meinem Vatterland / es ist ein schand“ und „Ihr thut alles mischen / mit faeulen Fischen“. Als Beweis der Sprachverwirrung folgt eine alphabetisch sortierte Litanei von über 300 Fremdwörtern.
 Philipp von Zesen
Philipp von Zesen
Die Adriatische Rosemund (Nachdruck)
Halle/Saale, 1899
„Deutschgesinnte Genossenschaft“
Der Schriftsteller und Übersetzer Philipp von Zesen (1619–1689) gründete die Sprachgesellschaft „Deutschgesinnte Genossenschaft“. Wegen seiner umfassenden Reformvorschläge wurde er vielfach angefeindet. Am Ende des hier gezeigten Romans von 1645 findet sich eine Liste „eingedeutschter“ Fremdwörter. Erfolgreich waren unter anderem „Tagebuch“ für Journal, „Verfasser“ für Autor, „Mundart“ für Dialekt, „Bücherei“ für Bibliothek und „Grundstein“ für Fundament.
 Georg Philipp Harsdörffer
Georg Philipp Harsdörffer
Frauenzimmer Gesprechspiele [...], Zweyter Theil
Nürnberg, 1657
Leihgabe Museum Otto Schäfer, Schweinfurt
„Sprachverderbung“
Der Nürnberger Dichter Georg Philipp Harsdörffer (1607–1658) vergleicht in seinen Schriften die „Sprachverderbung“ durch Fremdwörter mit der „Franzosenkrankheit“ Syphilis. Vor allem Kaufleute hätten nicht nur „frembde Wahren“, sondern auch „frembde Woerter“ eingeführt und damit die deutsche Sprache „zermartert“. Wie die meisten seiner Zeitgenossen plädiert aber auch Harsdörffer für einen differenzierten Umgang mit Fremdwörtern: Wenn sie allgemeinverständlich seien und es keine gute deutsche Entsprechung gebe, könne man sie behalten.
Für den Umgang mit unverständlichen Fremdwörtern findet sich in Harsdörffers Werk „Frauenzimmer Gesprechspiele“ ein ungewöhnlicher Vorschlag: Wer in geselliger Runde ein solches Fremdwort gebrauche, solle zur Strafe ein Glas Wasser in einem Zug austrinken.
 Joachim Heinrich Campe
Joachim Heinrich Campe
Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der
unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke Braunschweig, 1813
Leihgabe der Landesbibliothek Coburg
„Verdeutschungsarbeit“ zur „Volksbildung“
Dem Pädagogen und Theologen Joachim Heinrich Campe (1746–1818) war die „Volksbildung“ ein Anliegen. Als Motiv für seine „Verdeutschungsarbeit“ sah er die Notwendigkeit einer allgemeinverständlichen und klaren Sprache. Nur so könne das „einfache Volk“ politische Entscheidungen nachvollziehen. Innerhalb von 23 Jahren erarbeitete er ein Verzeichnis mit über 11.000 „Ersatzwörtern“. Etliche seiner Vorschläge verwenden wir heute ganz selbstverständlich: „Feingefühl“ für Takt, „altertümlich“ für antik, „herkömmlich“ für konventionell, „fortschrittlich“ für progressiv. Die meisten seiner Vorschläge fanden hingegen keinen Eingang in unseren Alltagswortschatz: weder „verinseln“ für isolieren noch „Freveltat“ für Attentat, „Schneegestürze“ für Lawine, „Menschenschlachter“ für Soldat oder „Zwangsgläubiger“ für Katholik.
 Johann Heinrich Meynier
Johann Heinrich Meynier
Neues Conversations- und Zeitungs-Lexicon
Nürnberg, 1821
„... zur Erläuterung des Unverständlichen ...“
Das 1821 veröffentlichte Fremdwörterbuch stammt aus der Feder des Erlanger Hugenotten-Nach-kommen Johann Heinrich Meynier (1764–1825). Gedacht war es als Hilfsmittel „zur Erläuterung des Unverständlichen in den Zeitungen“. Im Vorwort erwähnt Meynier „das eifrige Bestreben, welches sich seit der Befreiung unseres Vaterlandes von dem Joche der Franzosen geäußert hat, auch die deutsche Sprache von den Spuren ihrer Herrschaft zu reinigen“. Er selbst vertritt eine gemäßigte Haltung: Ersetzt werden sollten nur Fremdwörter, für die bereits ein „edles“, „vollgültiges“, „befriedigenes“ deutsches Wort existiere. Andernfalls müsse das „bessere ausländische Wort den Vorzug vor dem schlechteren inländischen erhalten, so wie edle Fremdlinge, die sich in einem Lande angesiedelt haben, mehr Achtung verdienen und genießen als Inländer, die ihnen an Bildung und Verdiensten weit nachstehen“.
 Carl Blasendorff
Carl Blasendorff
Das Fremdwörterunwesen [...]
Berlin, 1886
Leihgabe der Universitätsbibliothek Erlangen
„Das Fremdwörterunwesen“
Mit zahlreichen Beispielen versucht der Philologe Carl Blasendorff (1841–1901) zu zeigen, „wie sehr wir uns an unserer Muttersprache versündigen“. Weil er das Übel an der Wurzel packen möchte, empfiehlt er, bereits in der Schule – „im Bewußtsein vaterländischer Pflicht“ – fremde Ausdrücke zu verdeutschen und so „den Sprachschatz vor Schaden zu bewahren“. Tatsächlich strotzte zu Blasendorffs Zeit das Deutsche von Fremdwörtern wie General-Entreprise, insinuant, incroyable oder Table d’hôte, die heute längst vergessen sind. Blasendorff wettert aber auch gegen damals neue Wörter, deren fremdsprachige Herkunft wir heute kaum noch bemerken: Prozent, elegant, Original, sympathisch, Kandidat, Delikatesse, normal …
 Eduard Engel
Eduard Engel
Entwelschung. Verdeutschungswörterbuch
Leipzig, 1918
„Entwelschung“
Eduard Engel (1851–1938), klassischer Philologe, Romanist und Sanskrit-Student, promovierte auf Lateinisch, heiratete eine Spanierin, schrieb über griechische, englische und französische Literatur. Im Lauf seines Lebens wurden seine politischen und sprachwissenschaftlichen Ansichten immer konservativer. Während des Ersten Weltkriegs beklagte er die „grenzenlose ausländernde Sprachsudelei“, die „sprachliche Entvolkung Deutschlands“ und forderte die „Ausrottung dieses Krebsgeschwürs am Leibe der deutschen Sprache“. Obwohl er nationalsozialistische Ansichten teilte, erhielt er wegen seiner jüdischen Herkunft ab 1934 Veröffentlichungsverbot und starb in Armut.