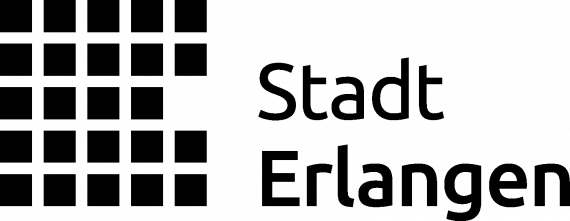Anglizismen – Must-have oder No-Go?
Die Einwanderung englischsprachiger Begriffe, sogenannter Anglizismen, ist kein neues Phänomen. Im Gegenteil: Schon vor über 300 Jahren kamen durch Handel und Technologien zahlreiche Wörter aus England zu uns. Seit dem Zweiten Weltkrieg bereichern vermehrt US-amerikanische Begriffe unsere Sprache. Da das Englische und das Deutsche eng verwandt sind, fügen sich viele Anglizismen nahtlos in die deutsche Grammatik ein.
Die Kritik an übermäßigem Fremdwortgebrauch, der häufig als „Imponiergehabe“ wahrgenommen wird, ist ebenfalls nicht neu – heutzutage richtet sie sich besonders gegen Anglizismen. Dahinter steckt bisweilen eine generelle Ablehnung des US-amerikanischen Einflusses durch Wirtschaft, Medien und Popkultur. Am Beispiel von Anglizismen wird deutsche Identität verhandelt – Sprache im Stellvertreterkrieg.
Gegen diese kulturpessimistische Sichtweise wenden sich selbsterklärte Verteidiger der Anglizismen. So kürt seit 2010 eine Jury aus Linguistinnen und Linguisten den „Anglizismus des Jahres“, der die deutsche Sprache wesentlich bereichert habe. Ob jedoch ein englisches Wort in unserem Sprachschatz eine Eintagsfliege bleibt oder sich dauerhaft etablieren kann, liegt einzig in der Hand der Sprecherinnen und Sprecher.
Audio-Datei: Essigs Exkursion: Deadline

 Rudolf Lubeley
Rudolf Lubeley
Sprechen Sie Engleutsch? Eine scharfe Lanze für die deutsche Sprache
Isenhagen, 1993
„Engleutsch“
Der Verfasser bemüht sich, „die Überfremdung“ der deutschen Sprache durch das Englische „zu bekämpfen“ und macht zahlreiche Vorschläge zur Verdeutschung englischer Begriffe, beispielsweise:
- Actionfilm = Reißer
- Babysitter = Bebihüter
- Band = Kapelle
- Bodybuilding Studio = Körperbildungsschule
- Carport = Autolaube
- Discjockey = Diskojakob
- Freak = Ausbold
- Hooligan = Radauer
- Pay-TV = Münzfernsehen
- Rushhour = Raschzeit
- Talkshow = Telestammtisch
- Timing = Zeitpunktung
 Dieter Stein/Günter Zehm (Hg.)
Dieter Stein/Günter Zehm (Hg.)
Rettet die deutsche Sprache. Beiträge, Interviews und Materialien zum Kampf gegen Rechtschreibreform und Anglizismen
Berlin, 2004
„Rettet die deutsche Sprache“
Der Sammelband, auf dessen Umschlag sechs nichtdeutsche Wörter vorkommen, polemisiert gegen die Rechtschreibreform der 1990er Jahre und gegen die „Verenglischung unserer Sprache“, die als „beschämende Entwicklung“, ja „Manipulation“ verstanden wird. Aus dem Englischen übernommene Redewendungen zeugten von „Faulheit, Ignoranz und der Tendenz, sich anzubiedern“. Statt der „Verhunzung der schönen deutschen Sprache“ durch Anglizismen wird ein „gesunder Stolz auf die Schönheit der deutschen Sprache und ihrer Dichtung“ empfohlen, denn „die moderne deutsch-englische Schimpansensprache“ sei „für eine Vermittlung kultureller Werte ungeeignet“.
 Achim Elfers (Hg.)
Achim Elfers (Hg.)
Der Anglizismen-Index 2021. Deutsch statt Denglisch
Paderborn, 2021
„Deutsch statt Denglisch“
Der 1997 gegründete Verein Deutsche Sprache (VDS; ursprünglich „Verein zur Wahrung der deutschen Sprache“) kritisiert die zunehmende Verwendung von Anglizismen in der Alltagssprache. Er führt einen „Anglizismenindex“, vergibt die Negativauszeichnung „Sprachpanscher des Jahres“ und bemüht sich seit vielen Jahren darum, der deutschen Sprache Verfassungsrang zu geben.