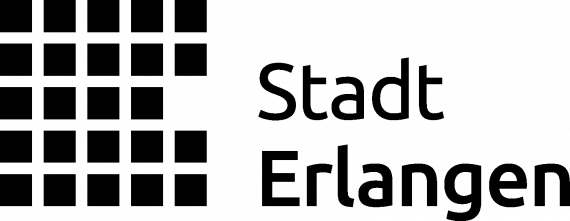Umstrittene Wörter: Das Beispiel „Mohr“
Die Frage, welche Wörter wir wie verwenden, löst manchmal hitzige Debatten aus. Mal geht es um kulturelle Aneignung, mal um den Ursprung und die Konnotation eines Wortes, wie beim Beispiel „Mohr“. Im Lateinischen bedeutete „maurus“ als Adjektiv „braun, dunkel“, als Substantiv bezeichnete es die (dunkelhäutigen) Bewohner Nordwestafrikas. Davon abgeleitet sind die Vornamen „Maurus“, „Maurice“ und „Moritz“, die geographischen Bezeichnungen „Mauretanien“ und „Mauritius“, ebenso die Volksbezeichnung „Mauren“, die schon in althochdeutscher Zeit, nämlich im 8. Jahrhundert, als „mor“, entlehnt wurde.
Spätestens im 16. Jahrhundert diente der Begriff als allgemeine Bezeichnung für Menschen mit dunkler Hautfarbe. Im Zuge der Kolonialisierung wurde der „Mohr“ vom vermeintlich primitiven „Neger“ unterschieden und als „edel“ aufgewertet, jedoch nie als den Europäern gleichwertig. Die krude Annahme war: Wer „verbrannte Haut hat“, kommt aus derart heißen Gebieten, dass vernünftiges Denken dort unmöglich ist. Die dennoch reizvolle Exotik führte hierzulande zur Namensgebung verschiedener Marken, Geschäfte oder auch Straßen und Plätze.
Aufgrund der Begriffsgeschichte und der stereotypen, zumeist abwertenden Zuschreibungen gelten heute beide Begriffe – „Neger“ und „Mohr“ – als diskriminierend.
 Hauszeichen „Mohr“
Hauszeichen „Mohr“
Erlangen, um 1750
Leihgabe der Mohren-Apotheke Erlangen
Mohr
„Mohren-Apotheken“ mit Mohren als Hauszeichen gibt es überall in Deutschland, auch in Erlangen. Die Tradition des Namens reicht mindestens bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die stereotype Figur des Mohren steht hier wahrscheinlich als Sinnbild für das breite Angebot an Heilmitteln aus „exotischen“ Ländern, vielleicht auch für die Einflüsse der maurischen Medizin. Die gezeigte Skulptur war ursprünglich an der Fassade der Mohren-Apotheke in der Bismarckstraße angebracht.