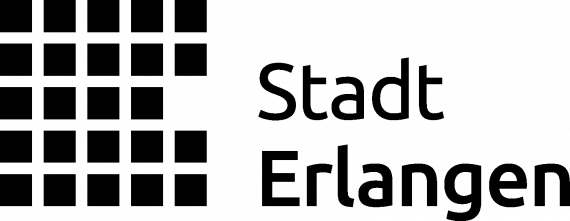Pille, Bypass und Bandage – Medizin
Viele Fachsprachen sind reich an Fremdwörtern aus international verständlichen „Gelehrtensprachen“. Über viele Jahrhunderte waren dies Griechisch und vor allem Latein.
Die Wurzeln der abendländischen Medizin reichen weit in die Antike, zu Ärzten wie Hippokrates und Galen. Das Wort „Medizin” selbst kommt vom lateinischen „ars medicina“ (Heilkunst). Bis in unsere Zeit spielen die „alten Sprachen“ im Gesundheitswesen eine wichtige Rolle und werden von der modernen Medizin sogar um neue Begriffe ergänzt: Radiologie, Endoskopie, Antibiotikum, Chemotherapie. Seit der Aufklärung kamen zum medizinischen Wortschatz viele französische Wörter hinzu, im 20. Jahrhundert immer mehr englische.
Obwohl es sich um eine Fachsprache handelt, haben viele medizinische Fremdwörter in die Alltagssprache Eingang gefunden und werden auch im übertragenen Sinne benutzt: Da wird eine Umgehungsstraße zum Bypass gegen den Verkehrsinfarkt, Politiker verteilen Placebos und stellen Diagnosen.

Medizinische Fachbegriffe und ihre Herkunft

Griechisch
Katheter
Schon vor 2400 Jahren verwendete man „katheter“ zur Unterstützung der Blasenfunktion, vor etwa 400 Jahren gelangte das Wort aus der Medizin- in die Alltagssprache.
Katheter von Uronovia/UroNova
Kaiserslautern/Erlangen, 2019
Stethoskop
Sein Erfinder René Laënnec nannte 1819 das Gerät nach den Wörtern „stethos“ für „Brust“ und „skopein“ für „betrachten, schauen, untersuchen“.
Stethoskop aus dem „Spital Erlangen“
wohl 1. Hälfte 20. Jahrhundert
Elektrokardiogramm
Auch „Herzschrift“ genannt, setzt sich das Wort aus den griechischen Wörtern für „Bernstein, Elektrizität“, „Herz“ und „schreiben“ zusammen. Das zugehörige Gerät heißt demnach Elektrokardiograf.
Elektrokardiograf „cor12“ von corscience
Erlangen, 2019
Thermometer
„Thermos“ heißt „warm“, „metron“ so viel wie „Maß“.
Thermometer aus der Adler-Apotheke Erlangen
wohl 2. Hälfte 20. Jahrhundert

Latein
Inhalator
Die Bezeichnung wurde über das Französische aus dem Lateinischen übernommen, wo „inhalare“ noch „zuhauchen“ oder „anhauchen“ hieß bzw. „halare“ „hauchen, duften, ausdünsten“. Es wurde wohl als Gegenwort zum französischen „exhaler“ (ausströmen) aufgefasst.
Inhalator aus der Frauenklinik Erlangen
1. Hälfte 20. Jahrhundert
Infusion
Das lateinische „infundere“ bedeutet „hineingießen“. Im späten 18. Jahrhundert wurde Infusion noch für verschiedene Formen des Einträufelns von Flüssigkeiten verwendet, im 20. Jahrhundert dann im heutigen Sinn – also als Medikamentenabgabe direkt ins Gefäß mit größeren Mengen Flüssigkeit als bei einer Injektion.
Jaques Pfrimmer, Inhaber der Pfrimmer Pharmazeutische Werke & Co. KG in Nürnberg, entwickelte 1925 in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen die erste industriell gefertigte Infusionslösung „Tutofusin“, die ab 1951 am neuen Firmensitz in Erlangen hergestellt wurde.
Ampulle mit Infusionslösung „Tutofusin“ von Pfrimmer Nürnberg/Erlangen, 1930–1959
Leihgabe Krankenhausmuseum Bielefeld
Spekulum
Nur das „k“ unterscheidet unser Wort vom lateinischen „speculum“ für „Spiegel“. Sogar eine sprachgeschichtliche Verwandtschaft mit „spähen“ lässt sich herstellen, auch mit spekulieren und Spektakel, nicht aber mit Spekulatius.
Spekulum aus dem Spital Erlangen
undatiert

Französisch
Bandage
Die Bandage ist eigentlich eine Rückkehrerin. Ihre Ursprünge liegen im germanischen „*bend-a“ (binden), das Ableger im Französischen bildete: „bande“ für „Binde“ oder auch „bander“ für „verbinden“. Innerhalb des Französischen erfolgte die Ableitung „bandage“ als fester Schnür- oder Stützverband, die wir dann „zurückübernahmen“.
Bandage aus der Adler-Apotheke Erlangen
1. Hälfte 20. Jahrhundert
Tablette
Die Tablette beruht, wie das Tablett, auf der Verkleinerungsform des französischen „table“ („Brett“ oder „Tisch“), das wir um 1900 aus dem Französischen übernahmen. Die pharmazeutische Bedeutung erhielt die Tablette erst im 20. Jahrhundert in Anlehnung an die zu flachen Scheiben oder Täfelchen gepressten Medikamente.
Presse für Tabletten aus der Adler-Apotheke Erlangen
1. Hälfte 20. Jahrhundert
Pastille
Das Wort Pastille wurde im 18. Jahrhundert aus dem lateinischen „pastillus“ („Kügelchen aus Teig“, „Brötchen“), einer Verkleinerung von „panis“ (Brot), entlehnt. Wir bezeichnen damit seit dem 18. Jahrhundert Kügelchen mit im besten Fall heilsamen Wirkstoffen.
Hals-Pastillen „Erlatyron“ aus der Adler-Apotheke Erlangen
20. Jahrhundert
Nasen-Dusche
Der Weg der Dusche führte vom lateinischen „ductio“ (Leitung) über das italienische „doccia“ zum französischen „douche“, wie man es im 18. Jahrhundert bei uns übernahm und später eindeutschte.
Nasen-Dusche von Büttner-Frank
Erlangen-Tennenlohe, ca. 2019
Audio-Datei: Essigs Exkursion: Quarantäne

Quarantäne
Baby-Bodysuit „Quarantäne-Baby 2021“
Leipzig, 2021

Englisch
Stent
Die Herkunft des Wortes für Verstärkungen vor allem von Röhren aus dem Englischen ist klar, seine Entstehung seit dem 19. Jahrhundert sehr umstritten. Wir zeigen hier die größten und die kleinsten Stents, die – auch an der Uniklinik Erlangen – im menschlichen Körper eingesetzt werden.
Stent Graft aus der Gefäßchirurgie der Uniklinik Erlangen
Arizona (USA), 2015
Coronarstent aus der Herzchirurgie der Uniklinik Erlangen
2010er Jahre
i-Stent aus der Augenklinik der Uniklinik Erlangen
USA, ca. 2020
AIDS
1981 wurden in den USA erste Fälle dieser Krankheit diagnostiziert, die seit 1982 die Bezeichnung „Acquired Immune Deficiency Syndrome“ (erworbenes Immunschwächesyndrom) trägt. Schon bald setzte sich im offiziellen Sprachgebrauch das Akronym AIDS durch, das seit 1986 im Duden steht.
AIDS-Teddy der AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth
Kirchardt, 2019
Bypass
Die Herzchirurgie, die in angelsächsischen Ländern entwickelt wurde, übernahm die englische Bezeichnung für „Umgehung“, „Umleitung“ für den operativen Eingriff, bei dem Umgehungen von Blutgefäßen angelegt werden. Die erste Operation dieser Art in Deutschland wurde 1969 in Erlangen durchgeführt.
Bypass-Modell
Coburg, 2020
Leihgabe der Firma SOMSO Modelle GmbH