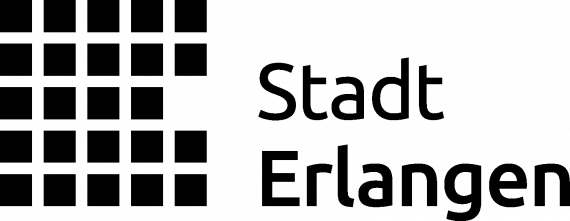À la mode – Die Hugenotten und andere Franzosen
Sie kamen als erwünschte Flüchtlinge in deutsche Gebiete: die Hugenotten. Wegen ihres Glaubens aus Frankreich vertrieben, fanden sie unter anderem in Erlangen Aufnahme. Inwieweit sie die Sprache ihrer deutschen Nachbarn beeinflussten, lässt sich nicht im Einzelnen sagen. In den Handwerken, die Hugenotten in Erlangen einführten, haben sich jedenfalls viele französische Fachbegriffe erhalten.
Doch auch unabhängig von den Hugenotten übte das Französische im Barock einen großen Einfluss auf die deutsche Sprache aus. Das benachbarte Frankreich war kulturelles Vorbild, nicht nur des Adels. In der „Alamodezeit“ des 17. Jahrhunderts entstanden unzählige „Gallizismen“. Einige sind bis heute gebräuchlich: Mode, Parfüm, Frisur, Toilette. In Berlin, wo ebenfalls viele Hugenotten lebten, kennt man heute noch blümerant (von „bleu mourant“ – sterbendes Blau), Bulette (von „boulette“ – Kügelchen, Bällchen) und das umgangssprachliche Bulljong (von „bouillon“).
Unter dem Einfluss Napoleons kamen noch einmal französische Wörter ins verbündete Bayern. Danach trug die wachsende Franzosenfeindlichkeit zu einem Rückgang des Einflusses bei. Im Laufe des 19. Jahrhunderts und besonders stark in der Nachkriegszeit etablierte sich als neue „Prestigesprache“ das Englische: Aus dem Mannequin wurde das Model, aus dem Rendezvous das Date.


Glacé-Handschuhe
Die Hugenotten verstanden es, feine, wie Eis („glacé“) glänzende Glacéhandschuhe zu fertigen, die bei uns sprichwörtlich wurden.
Glacè-Handschuhe aus Ziegenleder, Anfang 20. Jahrhundert
Potschamperl
Bis ins 20. Jahrhundert hinein benutzte man den Nachttopf, französisch „pot de chambre“. Das fein klingende Wort veränderte der Dialekt zum etwas derben Potschamper(l).
Nachttopf, 1. Hälfte 20. Jahrhundert
Chaise
Im Fränkischen sagt man zu einem alten Auto manchmal Schesn, was auf das französische „chaise“ für eine leichte Kutsche zurückgeht.
Spielzeugauto, Nürnberg, 1960er Jahre
Gendarm
Die französische Bezeichnung des Polizeisoldaten „gendarme“ ist in ganz Süddeutschland als Name für den (Dorf-)Polizisten verbreitet. Sein Ursprung ist der französische Plural „gens d’armes“ – bewaffnete Männer. Im 19. Jahrhundert setzte sich die Entlehnung durch. Vor allem das Kasperletheater sorgte für die liebevolle Kurzform Schandi.
Handpuppe aus Kasperletheater
1. Hälfte 20. Jahrhundert
Parasol
Die französische Bezeichnung für den Sonnenschirm „parasol“ übertrug man in Bayern und Franken auch auf Schirmpilze. Im Erlanger Eichenwald befand sich von etwa 1820 bis 1933 ein mit Stroh gedeckter Holzpavillon, der wegen seiner Form auch Parasol genannt wurde.
Paraplü
Eine im Fränkischen und Bayerischen nur leicht veränderte Übernahme liegt bei Parablü für „Regenschirm“ aus französisch „parapluie“ vor.
Regenschirm, um 1900
Audio-Datei: Essigs Exkursion: Kinkerlitzchen

Kinkerlitzchen
Vom Eisen-, Werkzeug- und Kleinteilehandel, den Hugenotten „quincaille(erie)“ nannten, entwickelte sich der im 19. Jahrhundert verballhornte Ausdruck für Kleinkram.
Audio-Datei: Erlanger Französisch
 Foto: Rudi Stümpel, 1956
Foto: Rudi Stümpel, 1956
Stadtarchiv Erlangen, VIII.8245.N.1/5
Café Mengin
Das Café Mengin wurde 1863 von dem Urenkel einer im 18. Jahrhundert eingewanderten Hugenottenfamilie gegründet. Der Nachname Mengin ist eine der wenigen Spuren der französischen Sprache, die sich im Stadtbild bis heute erhalten haben.