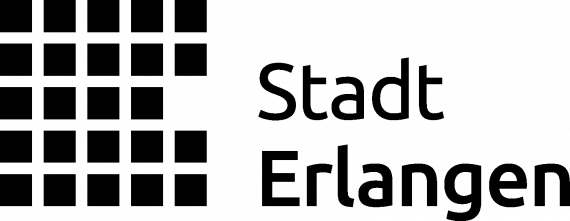Nouvelle Cuisine
Küche lebt vom internationalen Austausch. Selbst vermeintliche „Nationalgerichte“ entpuppen sich bei genauem Hinsehen als bunte Mischung verschiedenster Einflüsse und Sprachen. Die Breze stammt aus dem Lateinischen und die in deutschen Küchen unverzichtbare Kartoffel ist bekanntlich ein Import aus Südamerika.
Wie auch die Mode folgen Essgewohnheiten gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends. Jahrhundertelang galt die französische Küche als Vorbild und Bezeichnungen für Zubereitungsmethoden, wie gratinieren, spezielles Küchengerät, wie Kasserolle, und Gerichte, wie Suppe oder Kotelett, wurden aus dem Französischen übernommen. Der US-amerikanische Einfluss brachte nach 1945 Burger und Barbecue nach Deutschland, die sogenannten „Gastarbeiter“ etablierten ab den 1960er Jahren Pizza, Gyros und Döner Kebab, und heute sind Bubble Tea und Sushi in aller Munde.


Werbetafel „Restaurant Nino“
Werbetafel
wohl 1970er Jahre
Audio-Datei: Essigs Exkursion: Kartoffel
 Goldene Kartoffel
Goldene Kartoffel
Leihgabe Stadt Rehau
Kartoffel
Seit 1998 verleiht die Stadt Rehau die „Goldene Kartoffel“. Der Preis soll an den ersten feldmäßigen Kartoffelanbau in Deutschland erinnern, der um 1746 in Pilgramsreuth (seit 1978 Gemeindeteil von Rehau) erfolgte. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die sich um die Wahrnehmung und Stärkung der Kartoffel als Nahrungsmittel verdient gemacht haben.

„Eingesalzenes unreifes Gemüse“ = Gurkensalat
Gurke
Die Bezeichnung wurde im 16. Jahrhundert aus einer slawischen Sprache entlehnt und geht auf das griechische „águros“ (unreif) zurück. Die Benennung bezieht sich darauf, dass die Gurke grün (unreif) geerntet wird.
Salat
Im 15. Jahrhundert wurde das italienische „salata“ (gesalzene (Salat)speise), übernommen. Zugrunde liegt das lateinische „sal“ (Salz).
„Verschlungene Unterarme“ = Brezel
Weil ihre Form an verschlungene Arme erinnert, geht ihr Name wohl auf das lateinische „bracchium“ (Unterarm) zurück.
„Fein gemahlenes Weizenmehl“ = Semmel
Das Lateinische „simila“ (fein gemahlenes Weizenmehl) kam schon im frühen Mittelalter ins Deutsche und erfuhr eine Bedeutungserweiterung zu „Brot aus Weizenmehl, Brötchen“.
„Gestreutes“ = Pasta
Seit der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das Wort durch den Einfluss der italienischen Esskultur im Sinne von „italienisches Nudelgericht“ gebräuchlich, entlehnt vom italienischen „pasta“ (Teig). Dieses geht zurück auf das griechische „pássein“ (streuen, besprengen) und bedeutet demnach eigentlich „Gestreutes“.
„Säuerliches“ = Sushi
Wohl vom altjapanischen „sushi“ (säuerlich) wurde die Bezeichnung für die Hauptzutat des Gerichts – erkalteter, säuerlicher Reis – übernommen. In westlichen Ländern wurde Sushi in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts populär.
„Von Rinderhirten zubereitetes Fleisch“ = Gulasch
Über Österreich kam das ungarische Lehnwort im frühen 19. Jahrhundert ins Deutsche. Zugrunde liegt das vom ungarischen „gulya“ (Rinderherde) abgeleitete „gulyás“ (Rinderhirt). „Gulyás“ ist die Verkürzung von „gulyás hús“ (Fleisch, wie es von Rinderhirten gekocht wird).
„Dickflüssiges“ = Joghurt
Die Bezeichnung wurde bereits in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts aus dem Türkischen entlehnt, auch wenn das Produkt selbst erst seit 1907 in Deutschland hergestellt wird. Zugrunde liegt das türkische „yoğun“ (dicht, dickflüssig).
„Schlürfspeise“ = Suppe
Aus den in Süddeutschland gesprochenen germanischen Dialekten entlehnten die Römer „soppe“ (eingeweichtes Brot, Brühe) zu lateinisch „suppa“ (eingetunkte Brotschnitte). Im 14. Jahrhundert kehrte „soupe“ (Brühe mit eingeweichtem Brot) aus dem Französischen zurück und verbreitete sich über das gesamte deutsche Sprachgebiet. Die Verwandtschaft der germanischen Ausgangsform mit „schlürfen, trinken, saufen“ lässt darauf schließen, dass die Speise ursprünglich schlürfend eingenommen wurde.

Soße
Das vom französischen „sauce“ abstammende Wort ist im Deutschen bereits im 15. Jahrhundert bezeugt und geht auf das lateinische „salsa“ („die Gesalzene (Brühe)“) zurück.
Kaffee
Venezianische Kaufleute brachten den Kaffee mit seiner arabischen Bezeichnung „qahwa“, was ursprünglich auch „Wein“ bedeuten konnte, im 16. Jahrhundert aus der Türkei nach Südwesteuropa. Ins Deutsche gelangte Kaffee über das französische „café“ und ist schon 1582 in einem deutschen Reisebericht nachweisbar.
Tee
Das seit dem 17. Jahrhundert bezeugte Wort stammt aus dem Chinesischen. Bis ins 20. Jahrhundert war im Deutschen die Schreibung „Thee“ gebräuchlich.
Wein
Die südliche Schwarzmeerküste und der Kaukasus gelten als Wiege der Weinkultur und Ursprungsgebiet von Wein. Die Germanen lernten das alkoholische Getränk von den Römern kennen und übernahmen das lateinische „vinum“ (Wein).
Sekt
Der früheste Beleg des Wortes im Deutschen stammt aus dem Jahre 1647 und bezeichnet eine Art süßen Likörwein. Ausgangspunkt ist das italienische „vino secco“, das ursprünglich einen süßen, schweren, aus Trockenbeeren gekelterten Wein bezeichnete. Über das französische „vin sec“ gelangte dessen Kurzform in andere europäische Sprachen. Der Bedeutungswandel von „süßer Trockenbeerwein“ zu „Schaumwein“ erfolgte um 1830.
Seidla
Vom Eimer zum Biergefäß: Im 13. Jahrhundert wurde das lateinische „situla“ (Eimer zum Wasserschöpfen) ins Deutsche übernommen.

„Typisch Fränkisch?“ (Interaktive Medienstation)
Wählen Sie ein Gericht aus und raten Sie, welche Zutaten und Bezeichnungen nicht heimisch sind.
- Nürnberger Lebkuchen
- Schäufele
- Karpfen blau
- Gerupfter
- Baggers