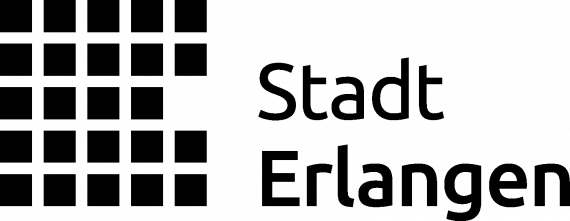Hyggelig
Die „gute Stube“ der Deutschen ist internationaler als man denkt. Seit Jahrhunderten orientiert sich die Einrichtung des trauten Heims an Vorbildern und Trends – und die kommen häufig aus dem Ausland. Aus dem barocken Frankreich gelangte die Kommode nach Deutschland, aus den USA wanderten nach dem Zweiten Weltkrieg Lounge Chair und Cocktailsessel ein, und bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts, lange vor der Eröffnung der ersten IKEA-Filiale, ist skandinavisches Design en vogue.
Ob Vintage, Shabby Chic oder Midcentury Modern – das Wohnzimmer soll heutzutage vor allem hyggelig sein. Dieses dänische Modewort hat die Welt im Sturm erobert, lässt sich aber ebenso schwer definieren wie seine deutsche Verwandte, die „Gemütlichkeit“. Man kann Hygge nicht in Worte fassen, man muss sie erleben.


Teppich
Das lateinische „tapetum“ machte keinen Unterschied, ob Wände, Tische, Sofas oder Fußböden damit bedeckt wurden. Ende des ersten Jahrtausends erfolgte durch die Veränderung zu „tep(p)ich“ die Unterscheidung zwischen Boden- matte und Wandverkledung.
Tapete
Im 16. Jahrhundert wurde aus dem Italienischen „tapeta“ (Teppich auf Fußböden, Tischen, Sofas, Wänden usw.) die Bezeichnung für „Wandverkleidung“ übernommen. Das Wort selbst geht über das lateinische „tapetum“ auf das griechische „tápes“ (Teppich, Decke) zurück.

Kamin
Das griechische „kaminos“ (Schmelzofen, Bratofen) kam über das Lateinische „caminus“ (Feuerstätte, Herd, Kamin) im Mittelalter ins Deutsche. Im süddeutschen Raum bezeichnet Kamin darüber hinaus den Schornstein.
Vase
Das bereits im 16. Jahrhundert bezeugte, aber erst seit dem 18. Jahrhundert allgemein übliche Wort ist aus dem Französischen entlehnt und geht auf das Lateinische „vas“ (Gefäß, Geschirr) zurück.
Büste
Die Entlehnung aus dem Italienischen erschien Anfang des 18. Jahrhunderts als „Buste“ bzw. „Busto“ im Deutschen. Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzte sich die französische Aussprache durch. Im 19. Jahrhundert erfuhr das Wort einen Bedeutungszuwachs: Nicht nur das Brustbild, sondern auch die weibliche Brust wurde als Büste bezeichnet.

Tisch
In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnete das Wort kein Möbelstück, sondern kleine hölzerne Platten, die einem einzelnen Esser zugleich als Auflage und Teller dienten. Zugrunde liegt das lateinische „discus“, das vom griechischen „diskos“ (Wurfscheibe, scheibenförmiger Gegenstand, Teller, Schüssel) stammt. Dieses wurde als „tisc“ (flache Schüssel, Speisetafel) ins Althochdeutsche entlehnt.

Kissen
Die erst seit dem 18./19. Jahrhundert allgemein übliche Form des Wortes beruht auf einer Entlehnung aus dem Französischen, das wohl eine galloromanische Wurzel mit der Bedeutung „Hüft-, Sitzkissen“ fortsetzt.

Roman
Im 17. Jahrhundert wurde das französische „roman“ entlehnt, das ursprünglich eine Erzählung in „romanischer“ (altfranzösischer) Volkssprache bezeichnete und sie damit von lateinischen oder griechischen Texten abgrenzte. Aus der Gattungsbezeichnung Roman entwickelte sich später die Epochenbezeichnung Romantik.
Novelle
Aus der italienischen „novella“ (kleine Neuigkeit), die wohl im 16. Jahrhundert ins Deutsche kam, wurde im 18. Jahrhundert ein literarischer Gattungsbegriff, der eine kurze, pointierte Erzählung bezeichnet. Die juristische Bedeutung Gesetzesnovelle ist schon älter.
Drama
Ende des 16. Jahrhunderts wurde der Gattungs- begriff für ein Schauspiel – wie zuvor schon Komödie und Tragödie – aus dem Griechischen entlehnt und dabei die Bedeutung als „aufregendes, erschütterndes Geschehen“ mit übernommen.
Sonate
Der musikalische Fachausdruck für „Instrumentaltonstück aus drei oder vier Sätzen“ wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus dem Italienischen entlehnt. Die lateinische Grundform bedeutet „Klingstück“ (zum Unterschied von der als „Singstück“ benannten Kantate).
Sinfonie
Schon im 13. Jahrhundert kam das ursprünglich griechische Wort über das Lateinische und Französische in der Bedeutung „Wohlklang, Harmonie“ ins Deutsche. Im 17. Jahrhundert wurde das italienische „sinfonia“ (Einklang; mehrstimmiger musikalischer Vortrag) als Bezeichnung für selbstständige Vor- oder Zwischenspiele einer Oper, Kantate oder Suite entlehnt.
Jazz
Anfang des 20. Jahrhunderts erreichte dieser Musikstil, der aus der Volksmusik der Afroamerikaner und Kreolen im südlichen Nordamerika und in der Karibik hervorgegangenen ist, Europa. Seine Bezeichnung wanderte dabei mit aus. Im Jargon bezeichnet das englische „jazz“ von Anfang an auch den Geschlechtsverkehr, daher handelt es sich vielleicht um eine kreolische Form des französischen „chasser“ (jagen), das für die raschen Bewegungen sowohl in musikalischer als auch in sexueller Hinsicht verwendet werden konnte.
Foxtrott
Der seit 1917 auch in Europa verbreitete Gesellschaftstanz wurde mitsamt seiner Bezeichnung aus Nordamerika übernommen. Das englische „foxtrot“ – ein Kompositum aus „fox“ (Fuchs) und „trot“ (Trab) – bezeichnete zunächst die Gangart des Pferdes, wenn es vom Trab in den Schritt fällt und wurde dann auf den Tanz übertragen, für den eine Aufeinanderfolge rascher und langsamer Bewegungen charakteristisch ist.
Audio-Datei: Radio
Audio-Datei: Lampe
Audio-Datei: Sofa